Tausende Predigten – aber keiner weiß, wie man liebevoll streitet? Was Christen in Deutschland vom Missionsfeld dringend lernen müssen: Familie ist kein Randthema, sondern der Ort, an dem Jesus-Nachfolge praktisch werden muss.
Inhalt
Wie das Missionsfeld meine Theologie auf den Kopf gestellt hat
Zehn Jahre auf dem Missionsfeld unter den Unerreichten haben meinen Glauben radikal herausgefordert. Vieles, was in Deutschland als selbstverständlich gilt, funktioniert hier nicht. Ich muss hier Fragen stellen, die mir in Deutschland nie begegnen würden – und entdecke Antworten, die ich in deutschen Kirchen nie hören würde. Ich wurde herausgefordert, loszulassen, zu lernen und manches neu zu entdecken – vor allem, wie Nachfolge im Alltag ganz konkret aussehen kann.
Der Theologe Martin Kähler sagte einmal:
„Mission ist die Mutter der Theologie.“
Und er hatte recht. Die ersten Christen entwickelten ihre Theologie nicht im Studierzimmer, sondern mitten im missionarischen Alltag – Paulus ringt unterwegs um Fragen wie: Müssen Heiden beschnitten werden? Welche Rolle hat das Gesetz? Wie lesen wir das Alte Testament im Licht von Jesus?
Genau dieses Ringen, das von Scheitern, Lernen und Ausprobieren geprägt war, hat auch mein theologisches Denken verändert. Und ich bin überzeugt: Was ich auf dem Missionsfeld lernen durfte, ist nicht nur für Asien relevant – ich glaube, dass diese Lektionen auch für die Kirche in Deutschland heilsam und belebend sein können. Die beiden folgenden Geschichten basieren auf wahren Begebenheiten.
Zwei Leben, ein Evangelium – und zwei völlig verschiedene Resultate
Moo’s Weg zu Jesus – und der Bruch mit ihrer Familie
Moo hörte zum ersten Mal von Jesus durch das Zeugnis einer Kommilitonin. Sie folgte der Einladung zu einer Evangelisation in einer lokalen Kirche. Am dritten Abend der Evangelisation spürte sie, wie etwas sie zu Jesus zog, und sie beschloss, ihr Leben Jesus zu geben. Voller Begeisterung fragte sie, wie sie nun als Christin leben solle.
Drei Dinge wurden ihr gesagt:
1) „Als Christin musst du regelmäßig den Gottesdienst besuchen, um zu lernen, wie man sich als Christ verhält.“
2) „Ab sofort darfst du an keinen Aktivitäten mehr teilnehmen, die buddhistische Elemente enthalten, weil du das Christentum und den Buddhismus nicht vermischen darfst.“
3) Du musst deiner ganzen Familie das Evangelium erzählen, damit sie von einer Ewigkeit in der Hölle gerettet werden können.“
Eifrig fing Moo an, diese drei Dinge umzusetzen. Sie flehte ihre Eltern an, sich vom Buddhismus abzuwenden und ebenfalls Christen zu werden. Doch diese lehnten ab – für sie war das Christentum die Religion der Weisen. Christ zu werden kam ihnen wie ein Verrat an der eigenen Kultur und Identität vor. Moo verpasste kein Treffen ihrer Gemeinde. Sie hatte immer weniger Zeit für ihre Familie und ihre alten Freunde. Moo verbrachte bald alle ihre freie Zeit in der Gemeinde. Dies führte zu einer Entfremdung von ihrer Familie und ihren alten sozialen Netzwerken.
Als einige Monate später ihre Tante starb, weigerte sich Moo, an der Bestattung teilzunehmen – weil sie buddhistische Elemente enthielt. Damit sandte sie, wenn auch unbeabsichtigt, eine klare Botschaft an die gesamte Großfamilie: „Ihr seid mir nicht mehr wichtig.“ Moo war ihrer Familie komplett fremd geworden – als hätte man sie durch eine andere Person ersetzt. Ein lokaler Pastor beschrieb die Situation passend mit folgendem Satz:
Wenn unsere Kirche einen schwachen Christen gewinnt, bekommen wir zweihundert starke Feinde aus den sozialen Netzwerken des Neubekehrten.
Moo ist kein Einzelfall. Ihre Geschichte wiederholt sich – mit unterschiedlichen Namen und Details – in zahllosen Familien.
Gaew’s Geschichte – und warum sie so anders verlief als Moo’s
Nach jahrzehntelanger Missionsarbeit in Asien wusste Greg, wie wichtig Familie im asiatischen Kontext ist. Als er Gaew kennenlernte und sie Interesse an Jesus zeigte, bat er sie, ihn ihrer Großfamilie vorzustellen. So baute er eine Beziehung mit der gesamten Großfamilie auf. Es gab viele Probleme und Streit in der Familie. Greg begann, ihnen inmitten ihres Alltags biblische Impulse zu geben – beim gemeinsamen Essen, Einkaufen und während Ausflügen.
Er lehrte sie den Wert von Vergebung und Jesu Priorisierung der Liebe. Der Fokus war auf realen Problemen. Greg lehrte sie, wie sie Jesus inmitten ihres Alltags nachfolgen können. Nach und nach erkannten die Familienmitglieder die Weisheit in seinen Worten – und wurden offen für die Quelle dahinter: Jesus selbst.
Immer mehr begannen, Jesus und seinem Weg der Liebe nachzufolgen. Jesus transformierte die Familie. Zerstrittene Familienmitglieder versöhnten sich, der Umgang miteinander wurde liebevoller und Probleme wurden überwunden. Die Veränderung in der Familie war so offensichtlich, dass die Nachbarn sich erkundigten, was diese Veränderung bewirkt hatte. Das Zeugnis der Familienmitglieder verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Heute folgen ca. 2000–3000 Menschen aus dieser unerreichten Völkergruppe Jesus nach, weil er diese zerstrittene Familie transformiert hat.
Familien sind der Schlüssel – Zeit, unseren Fokus neu auszurichten
Was unterscheidet die beiden Geschichten? Es ist die Art und Weise, wie Jesus-Nachfolge modelliert wurde. Zahlreiche Missiologen haben bereits die Problematik kritisiert, dass wir Christen dazu tendieren, neue Gläubige aus der Familie zu extrahieren und in eine christliche Bubble hineinzusozialisieren. Dies zerstört die Chance, dass die neue gläubige Person effizient als Zeugnis in der eigenen Familie funktionieren kann. Missiologe Alex Smith (2010:63) betont, dass der Glaube sich am einfachsten entlang familiärer Netzwerke ausbreitet. Diese bieten ideale Bedingungen für Evangelisation und Jüngerschaft, weil bereits tiefe Beziehungen bestehen.
Daher fordern viele Missiologen, ganze Familien in den Blick zu nehmen – nicht Einzelpersonen zu isolieren, sondern sie darin zu begleiten, wie sie Jesus mitten in ihrem familiären Alltag nachfolgen können. Wenn dabei praktische Liebe und die Wiederherstellung von Beziehungen im Zentrum stehen, werden die Neubekehrten zu einem lebendigen Zeugnis in ihrer Familie.
Was die Bibel betont – und wir oft übersehen
Warum deine Familie dein erstes Missionsfeld ist
Bisher lag der Schwerpunkt darauf, dass Jüngerschaft involviert ganze Familien zu erreichen und in sie zu investieren. Doch Paulus erinnert uns daran, dass diese Priorität der Familie nicht nur für andere gilt – sie muss bei uns selbst beginnen. Als Nachfolger Jesu sind wir nicht nur dazu berufen, andere Familien zu stärken, sondern unsere Nachfolge zuerst in der eigenen Familie zu leben. Paulus bringt diese Priorisierung der Familie mit überraschender Schärfe zum Ausdruck:
„Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt.“ (1 Tim 5,8 NGÜ)
Für Paulus war klar: Wer das Evangelium verkündet, muss es zuerst im eigenen Haus leben. In einer Welt, in der Individualismus und Familienzerbruch zunehmen, ist es notwendiger denn je, unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Familie zu richten. Denn gerade im Miteinander der Familie wird unser Glaube auf die Probe gestellt – und sichtbar. Die eigene Familie zu vernachlässigen bedeutet, den Glauben zu verleugnen.
Das wichtigste Gebot: die heilige „Dreieinigkeit“ der Liebe
Jesus hat das höchste Gebot so zusammengefasst: Gott lieben, den Nächsten lieben und sich selbst lieben (vgl. Mt 22,36–40). Diese drei Dimensionen sind untrennbar miteinander verbunden – eine Art „heilige Dreieinigkeit der Liebe“. Wenn wir eine dieser Dimensionen vernachlässigen, geraten die anderen aus dem Gleichgewicht. Christen neigen oft dazu, den Fokus einseitig auf die Liebe zu Gott zu legen – durch Lobpreis, Bibelstudium oder das Streben nach korrekter Lehre. Das alles ist wichtig, doch Jesus macht unmissverständlich klar: Unsere Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zum Nächsten (vgl. Joh 13,35; 1 Joh 4,20–21). Und diese beginnt im Alltag – in der Art, wie wir mit unseren Ehepartnern, Kindern und den Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld umgehen.
Revolution der Liebe – Jesu Bergpredigt im Alltag
Die Bergpredigt (Mt 5–7) ist eine praktische Ausarbeitung dieses höchsten Gebots. Sie zeigt, wie Liebe konkret gelebt wird – nicht in idealisierten Momenten, sondern mitten im Alltag, in Beziehungen, im Umgang mit Konflikten und im Schmerz. In der Bergpredigt lehrt Jesus, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Jesus ruft seine Jünger auf, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein (Mt 5,13–16). Das bedeutet: gelebte Liebe im Alltag – sichtbar, spürbar, transformierend. Menschen sollen durch unser Leben Gottes Schönheit spüren können. Und wo soll dieses Licht zuerst leuchten, wenn nicht in unserer Familie, in unserem Zuhause?
Im weiteren Verlauf der Bergpredigt legt Jesus eine radikale Ethik der Liebe dar. Er ruft zur Versöhnung auf, noch bevor man Gottesdienst feiert (Mt 5,23–24). Wer seinem Bruder zürnt oder ihn verachtet, soll erkennen, dass dies ernst und nicht zu vernachlässigen ist (Mt 5,21–22). Konflikte im familiären Kontext – mit Partner, Kindern, Eltern oder Geschwistern – gehören zu den häufigsten und tiefsten Verletzungen. Doch genau dort setzt Jesus an: Die Liebe zu Gott zeigt sich darin, ob wir den Mut zur Versöhnung aufbringen.
Auch den Umgang mit Sexualität und Ehe thematisiert Jesus (Mt 5,27–32). In einer von der Sünde zerstörten Welt ruft Jesus zur Treue und inneren Reinheit auf – ein Thema, das bis heute in allen Ehen hochrelevant ist. Es geht um Herzensverwandlung. Jesus will nicht äußerliche Gesetzestreue, sondern Integrität in unseren Beziehungen.
Ein weiterer zentraler Abschnitt handelt vom Umgang mit Konflikten und Gewalt (Mt 5,38–42). Jesus lehrt, nicht zurückzuschlagen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Diese Haltung beginnt nicht im politischen Aktivismus, sondern im Wohnzimmer – wenn wir lernen, nicht aus Wut oder Trotz zu reagieren, sondern mit Sanftmut, Geduld und Liebe.
Am Höhepunkt steht die Feindesliebe (Mt 5,43–48):
„Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“
Diese radikale Liebe ist der tiefste Ausdruck von Gottes Wesen. Genau dieses Wesen sollen auch wir widerspiegeln. In der Familie, wo wir uns am besten kennen und am häufigsten reiben, ist diese Liebe oft am schwersten – und gerade deshalb am notwendigsten.
Die Bergpredigt zeigt: Die Liebe, zu der Jesus uns ruft, ist keine abstrakte Idee, sondern ein Lebensstil. Sie beginnt dort, wo unser Charakter täglich geformt wird – im Umgang mit unserem Ehepartner, unseren Kindern, Eltern und den Menschen in unserem direkten Umfeld. Sie ist herausfordernd, kostspielig und nicht selten schmerzhaft. Aber genau darin liegt ihre Kraft: Sie verändert Menschen. Sie verändert Familien. Und dadurch verändert sie die Welt.
Die Familie als zentraler Ort der Jüngerschaft
Die Bergpredigt ist das Manifest des Reiches Gottes – und der Familienalltag ist das erste Übungsfeld. In der biblischen Perspektive ist die Familie nicht nur ein Ort des Zusammenlebens, sondern der Ort, wo wir geistlich wachsen. Hier lernen wir Geduld, Vergebung, Demut und dienende Liebe – nicht in idealisierten Momenten, sondern mitten im Konflikt, in Schwäche und im alltäglichen Scheitern. Deshalb ist es gerade die Familie, die zum fruchtbaren Boden für echte Nachfolge werden kann.
Die Vernachlässigung der Liebe in der Familie führt zur Heuchelei. Denn wer Gott predigt, aber zu Hause lieblos lebt, verfehlt das Evangelium. Die Wiederherstellung der Familie ist daher kein nebensächliches Thema, sondern ein zentraler Ausdruck der Jesus-Nachfolge. Nur wenn unser Glaube im engsten Kreis glaubwürdig gelebt wird, kann er auch nach außen wirken. Denn eine gesunde Familie wird zur Quelle der Heilung – für uns selbst, für unsere Freunde und für die Welt. Oder wie es ein asiatischer Freund von mir sagte:
Ich will auch Jesus nachfolgen, denn ich habe ihn in deiner Familie gesehen.
Ganz praktisch: So könnte es im Alltag aussehen
Themen, die fehlen – und warum das problematisch ist
Ich kenne viele Menschen, die seit Jahrzehnten treu in die Kirche gehen und unzählige Predigten gehört haben – und trotzdem kaum wachsen in Richtung eines Jesus-ähnlichen Charakters. Ich nehme mich da gar nicht aus: Ich habe den Glauben mit der Muttermilch in meiner frommen Landeskirche aufgesogen, später Theologie studiert und vermutlich tausende Predigten gehört. Und doch merke ich, dass ich in emotional herausfordernden Momenten im Familienalltag oft überfordert bin.
Es fällt mir schwer, meine Gefühle gesund zum Ausdruck zu bringen, wenn ich verletzt bin – oder zu wissen wie ich liebevoll reagieren kann, wenn meine Frau mir auf die Nerven geht (was natürlich nur ganz selten passiert). Obwohl ich tausendmal gehört habe, dass ich meinen Nächsten lieben soll, habe ich viel zu selten gelernt, wie ich das im Alltag konkret tun kann.
Diese Beobachtung weist auf ein grundlegendes Problem hin: In unseren christlichen Treffen legen wir oft einseitig den Fokus auf abstrakte Theologie und geistliche Prinzipien. Gott zu lieben wird gewöhnlich mehr betont als wie wir unseren Nächsten lieben können. Damit wir lernen, Liebe im Alltag zu leben, müssen wir als Christen mehr und tiefer über ganz praktische Themen sprechen:
Wie kommuniziere ich, ohne zu verletzen? Wie löse ich liebevoll Konflikte? Wie kann ich meine Identität in Christus finden und innere Wunden heilen? Wie setze ich gesunde Grenzen? Wie lebe ich eine liebevolle Partnerschaft und eine gesunde Sexualität? Wie kann ich meine Kinder zur Reife erziehen? Wie sieht ein gesunder Lebensstil aus der gut ist für Körper, Seele und Geist? Wie sieht ein gesunder Umgang mit sozialen Medien aus?
Diese Themen sind keine Nebensachen – sie sind zentral, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen und sein höchstes Gebot im Alltag umsetzen wollen. Wir benötigen eine neue Balance: Zwischen Theologie und Alltagsthemen, zwischen Gott lieben und den Nächsten lieben.
Jesus ging zu den Menschen – und wir?
Wir Christen neigen zu einer „Kommt-zu-uns“-Vorgehensweise: Wir leben in christlichen Bubbles, laden Sünder in unsere Gottesdienste ein und erwarten, dass sie sich an unsere Kultur, Sprache und Regeln anpassen. Damit legen wir die Last der Veränderung auf ihre Schultern.
Doch Jesus lebte den „Geht-zu-ihnen“-Ansatz: Jesus ist in unsere zerbrochene Welt gekommen, hat unsere Realität geteilt und „unter uns“ gewohnt (Joh 1,14). Er ging zu den Menschen, begegnete ihnen in ihrer Welt, aß mit ihnen und malte ihnen Gottes Liebe mit seinem Leben vor Augen. Es ist unbequem, unter Sündern zu leben – aber genau das ist der Weg Jesu. Anstatt Menschen in unsere Welt zu zwingen, sollten wir lernen, wie wir in ihrer Welt glaubwürdig leben können – als liebevolle, demütige und authentische Nachfolger Jesu.
Kanzel oder Wohnzimmer? Wo Jüngerschaft wirklich passiert
In traditionellen Gottesdiensten bestimmt der Pastor das Thema – und alle hören die gleiche Predigt, unabhängig davon, welche Herausforderungen sie gerade durchleben. Doch jeder Mensch bringt ganz individuelle, oft komplexe Fragen und Probleme mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Predigt exakt ins eigene Leben spricht, ist sehr gering.
Viel hilfreicher wäre ein Rahmen, in dem gezielte Jüngerschaft geschehen kann: kleine Gruppen, in denen Vertrauen wächst und jeder offen über seine Kämpfe sprechen darf. Dort kann gemeinsam gesucht werden, wie die konkreten Probleme auf eine Jesus-zentrierte Weise ganz praktisch gelöst werden können. Nicht allgemeine Theorie, sondern persönliche und konkrete Anwendung.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Richtung: Im Gottesdienst gibt es ein willkürlich gewähltes Thema, und die Zuhörer sollen versuchen, eine passende Anwendung für ihr Leben zu finden. In der Kleingruppe hingegen steht ein konkretes Problem aus dem Alltag im Mittelpunkt – und gemeinsam wird nach einer biblischen, Jesus-zentrierten Lösung gesucht. So wird Jüngerschaft vom Konsum zur echten Lebensveränderung.
Warum Jüngerschaft ohne Verletzlichkeit nicht funktioniert
Echte Ehrlichkeit über unsere tiefsten Kämpfe braucht einen geschützten Rahmen. In vielen Hauskreisen, die offen für jeden sind, fehlt oft das nötige Vertrauen, besonders wenn eine Person als „nicht sicher“ wahrgenommen wird. Doch Verletzlichkeit entsteht nur dort, wo man sich angenommen und verstanden fühlt – meist in kleinen, vertrauten Gruppen.
Solche Gruppen schaffen nicht nur Raum für offene Gespräche, sondern helfen auch dabei, das Gelernte wirklich umzusetzen. Am Ende eines Treffens kann gemeinsam überlegt werden, welcher konkrete Schritt im Alltag dran ist. Beim nächsten Mal wird liebevoll nachgefragt, wie es gelaufen ist – nicht mit Druck, sondern mit Ermutigung und gegenseitiger Unterstützung.
Wendepunkte nutzen: Jüngerschaft in den entscheidenden Momenten
Große Lebensereignisse wie eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes oder auch der Verlust eines geliebten Menschen bieten wertvolle Gelegenheiten zur Jüngerschaft. Freunde können sich versammeln, um Erfahrungen, Ermutigung, Trost und Weisheit weiterzugeben. Ob im Rahmen einer fröhlichen Feier oder in gemeinsamer Trauer – solche Momente schaffen Raum für tiefe Gemeinschaft und geistliches Wachstum, genau dort, wo das Leben uns prägt.
Fazit
Wenn wir Jesus-Nachfolge ernst nehmen, müssen wir sie dorthin zurückholen, wo Leben geschieht: in die Familie. Der Weg der Nachfolge führt nicht weg vom Alltag, sondern mitten hinein. Unsere Nachfolge beginnt nicht auf der Bühne, sondern im Wohnzimmer – im ehrlichen, manchmal chaotischen Miteinander mit den Menschen, die uns am nächsten stehen. Wer Jesus folgen will, muss lernen, ihn zuerst in der eigenen Familie zu verkörpern. Doch das genügt nicht. Wir dürfen auch die Familien unserer Jünger nicht übersehen. Es geht nicht darum, einzelne Personen aus ihrem familiären Umfeld herauszulösen, sondern darum, ganze Familien zu erreichen, zu stärken und in die Jesus-Nachfolge hineinzuführen. Familie ist kein Nebenschauplatz – sie ist das Herzstück von Nachfolge und Mission. Unsere eigene. Und die der Menschen, die wir begleiten. Denn eine gesunde, liebevolle Familie wird zum kraftvollen Zeugnis – und zieht Menschen zu Jesus, oft mehr als jede Predigt es könnte. Denn die Kraft, die Nationen verändert, beginnt mit der Liebe, die Familien verwandelt.
Bibliografie
Smith, AG. (2010). „Family networks: the context for communication“, in De Neui, P. (Ed.): Family and faith in Asia: the missional impact of social networks. Pasadena: William Carey Library, 47–76.




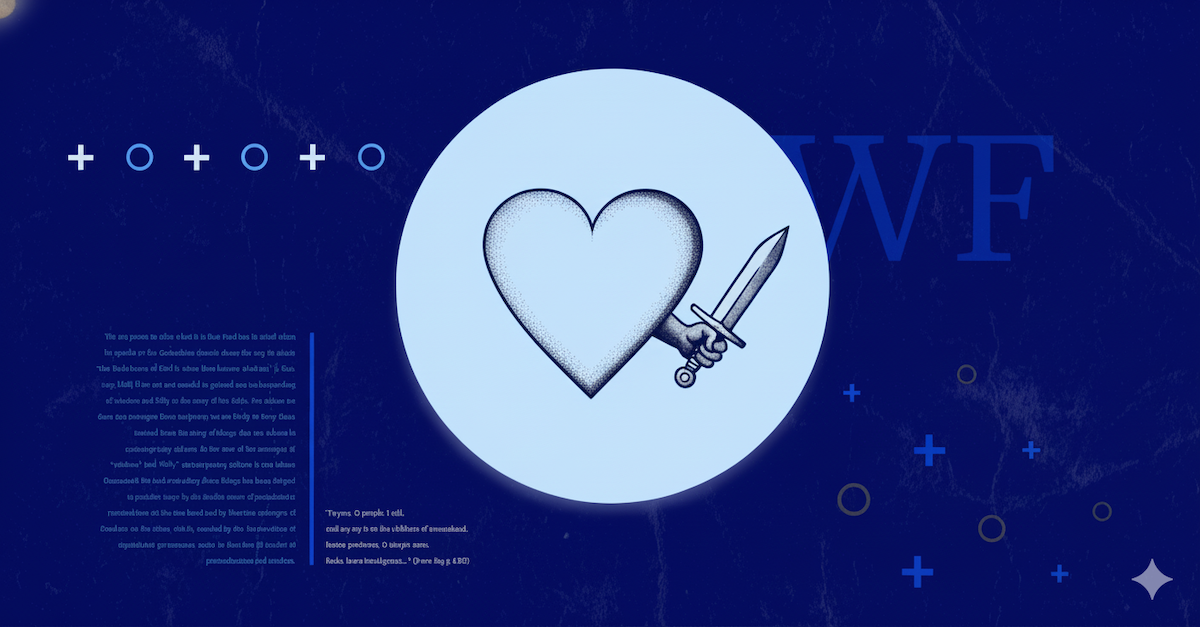
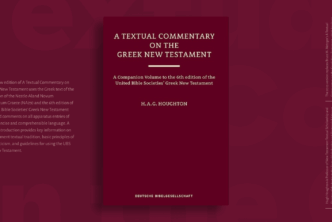
Vielen Dank für diese häufig vergessene Perspektive der Jüngerschaft. Meine Frau und ich erleben das als Opa und Oma, wie wir unseren Enkeln und ihren (noch) nicht gläubigen Eltern Jesus nahebringen. Was nützt alle Theologie, wenn wir dazu nicht fähig sind?
Vielen Dank für den Kommentar! Es freut mich sehr zu hören, dass du diese Perspektive auch in deinem eigenen Umfeld lebst. Großeltern haben oft eine besondere Möglichkeit, den Glauben ganz natürlich an die nächste Generation weiterzugeben. Gott segne dich und deine Frau für diese Aufgabe.
Vielen Dank für den tollen Artikel! Die Bedeutung der Familie und von Kleingruppen für das Wachsen im Glauben und das Umsetzen der Nächstenliebe ist mir wieder ganz neu bewusst geworden. Ein guter Impuls, den ich im Alltag umsetzen möchte.