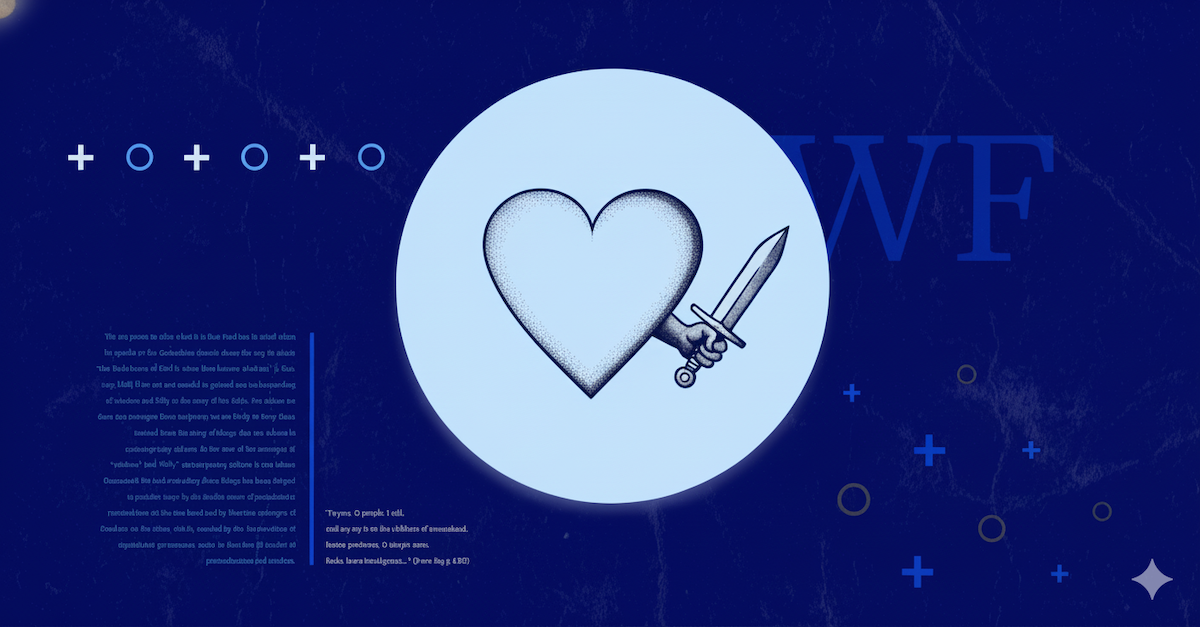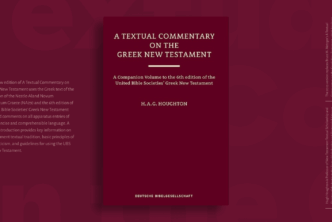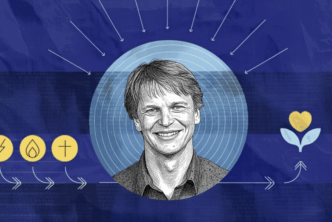Dieser Artikel zur Berpredigt ist mehr als nur eine Auslegung – er ist ein Blick in das Potenzial von Logos. Wir haben führende Kommentare und theologische Bücher aus unserer Software genutzt, um die verschiedenen Facetten von Matthäus 5,21–22 zu beleuchten. Die Zusammenfassung wurde von KI mit klaren Vorgaben erstellt. Jede Fußnote verweist dabei direkt auf das Buch, das auch in Ihrer digitalen Bibliothek auf Sie wartet. (Wir haben auf Seitenzahlen verzichtet, weil die kommentierte Bibelstelle klar ist.)
Lassen Sie uns gerne wissen, was Sie von diesem Experiment haltet.
In der Bergpredigt nimmt uns Jesus mit auf eine Reise unter die Oberfläche der Gebote, die wir zu kennen glauben 1. Er möchte nämlich keine Regeln abschaffen, sondern ihre tiefste, oft übersehene Bedeutung freilegen 2. An sechs Beispielen aus dem Leben zeigt er deshalb, was eine Gerechtigkeit, die unser Herz verändert, wirklich bedeutet 3. Den Anfang macht dabei das bekannte fünfte Gebot 4.
Inhalt
Das alte Gebot: Was alle kannten (Vers 21)
Jesus beginnt mit einer vertrauten Formel: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde…“ 5. Jeder Jude seiner Zeit wusste, was gemeint war, denn „schon mit 12 Jahren kannte der ‚normale’ Jude – man war dann ja Bar Mizwa (Sohn des Gebotes) und religionsmündig – die wichtigsten Gebote des AT“ 6. Folglich waren die Gebote „geläufig und sozusagen im Ohr“ 7.
Die Autorität der „Alten“ und des Gesetzes
Mit den „Alten“ sind dabei jedoch nicht nur irgendwelche Vorfahren gemeint, denn hier unterscheiden sich die Kommentatoren in ihren Akzenten. Joachim Gnilka präzisiert zum Beispiel, dass hier die Generation des Mose gemeint ist, jene, „die zusammen mit Josua ‚alles wussten, was Jahwe für Israel getan hatte’ (Jos 24,31)“ 8. Gerhard Maier betont hingegen, dass die „Alten“ „keinerlei abwertenden Sinn“ haben, sondern „einfach die früheren Generationen Israels“ bezeichnen, „die der Bundschließung am Sinai beiwohnten“ 9. Fiedler spricht von den „Vorfahren“ als der „Sinai-Generation“ 10. Allen ist gemein, dass es sich um die ursprünglichen Empfänger des Gesetzes handelt, was dem Gebot göttliche Autorität verleiht 11.
Mit der „Leideform ‚gesagt wurde’ umschreibt Jesus wieder Gottes Handeln, das auch durch Engel vermittelt sein kann“ 12. Das Passiv „es wurde gesagt“ ist demnach ein „theologisches Passiv“, das Gott als den eigentlichen Sprecher kennzeichnet 13.
Die mündliche Tradition der Schriftgelehrten
Das Zitat selbst ist zweigeteilt. Zuerst das direkte Wort Gottes: „Du sollst nicht töten“ (2. Mose 20,13) 14. Dann die daraus abgeleitete Rechtsfolge: „Wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen!“ Dieser zweite Teil „ist gewissermaßen ein Extrakt aus verschiedenen Stellen des AT (2. Mose 21,12; 4. Mose 16ff.; 5. Mose 17,8ff.)“ 15.
Remmers erklärt, dass dies „ein Zusatz“ war, „der in dem ursprünglichen Gebot nicht enthalten war“ 16 und „wohl seit der Babylonischen Gefangenschaft von den Schriftgelehrten hinzugefügten Nachsatz“ darstellt 17. Gnilka macht ebenfalls deutlich, dass hier „der Traditions- und Auslegungsvorgang mitreflektiert ist“ 18.
Das „Gericht“ meint hier zunächst „das Stadtgericht“ 19, wobei „nur die Oberinstanz an ‚der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird’, d. h. seit David und Salomo in Jerusalem“ lag 20. Maier hebt zudem hervor, dass „der Mord nicht durch Blutrache, sondern durchs Gericht geahndet werden soll“ und dies „die Vorzüge der alttestamentlichen Rechtsordnung“ zeigt, „die die menschlichste in der Alten Welt war“ 21.
Warum beginnt Jesus also mit diesem Gebot? „Das NT gibt darüber keine Auskunft“ 22, aber Maier vermutet: „Der Grund könnte aber sehr wohl darin liegen, daß Morde im Judentum – abgesehen von militärischen und politischen Auseinandersetzungen – äußerst selten waren. Vielleicht wollte Jesus gerade an dem Gebot, das die Juden am wenigsten zu verletzen glaubten, den Mangel an Gerechtigkeit aufdecken“ 23. Kühlein drückt es anders aus: „da entspannte sich schon einmal die Atmosphäre bei den Zuhörern damals, denn umgebracht hatte da vielleicht noch niemand jemanden“ 24.
Jesu neue Autorität: Die entscheidende Wende (Vers 22)
Dann folgt der Satz, der alles auf den Kopf stellt: „Ich aber sage euch…“ 25. Diese Worte sind von einer ungeheuren Autorität. Maier schreibt dazu: „Kein Hörer und kein Leser, der wirklich nachdenklich ist, kommt an der Frage vorbei: Welcher Mann hat das Recht, so zu reden?“ 26. Spurgeon formuliert die gleiche Frage: „Welcher Mann hat das Recht, so zu reden?“ 27. Folglich, so Maier, „denkt man daran, daß Mose dem Volk das Gesetz überbrachte, dann muß Jesus mindestens dieselbe Autorität haben wie Mose“ 28.
Bei der Deutung dieses „aber“ gehen die Kommentatoren jedoch leicht unterschiedliche Wege. Maier warnt vor Fehlinterpretationen: „Zwei falsche Deutungen müssen beim ‚Ich aber sage euch’ sofort abgewiesen werden“ 29. Es sei weder „das ‚Ich’ im Sinne des autonomen Ich des modernen Menschen“ noch bringe Jesus sich „in einen Gegensatz zum AT“ 30. Vielmehr ist sein „‚Aber’ nicht das ‚Aber’ eines menschlichen Rebellen oder diabolischen Gegners, sondern das ‚Aber’ der Enthüllung“ 31.
Rienecker betont deswegen: Das Wort „will nicht Mißachtung der Alten sein […], nein, nicht Mißachtung des Alten, sondern höchste Beachtung des Alten“ 32. „Das Gesetz ist unbedingt heilig, ist unwandelbar […]. Aber das Gesetz Gottes schaut nicht nur auf die Tat, sondern blickt tiefer, sieht auf den Ursprung der Tat, auf die dahinter liegende Gesinnung” 33.
Fiedler schlägt eine andere Nuance vor, denn er möchte das „aber“ „nicht als Gegensatz, nicht als aber verstehen, sondern als weiterführendes nun“ 34, um zu betonen, dass „Jesus seiner Schülerschaft Weisung für die Gestaltung eines der Tora gemäßen Lebens“ gibt 35. Maier aus dem HTA-Kommentar hält jedoch „an dem adversativen Charakter des δέ [de], also an dem aber“ fest 36.
Über die christologische Bedeutung sind sich die Kommentatoren allerdings einig. Im „Ich aber sage euch“ liegt „die indirekte Offenbarung Jesu als Gottessohn“ 37. Schließlich konnte „nur der erlösende Messias und Gottessohn seine Autorität über die des Mose stellen“ 38.
Die Wurzel des Tötens: Warum Zorn in der Bergpredigt so ernst ist
Jesu erste Enthüllung ist ein Schock: „Jeder, der seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen.“ Damit verlagert Jesus den Tatort direkt in unser Herz. Rienecker erklärt den Zusammenhang: „So greift Christus an die Wurzel, ist (radikal = Wurzel) und zeigt uns, daß der Zorn dem Mord gleich kommt” 39. Denn „‚Morden’ ist nicht nur im Akt der Lebensvernichtung gegeben, sondern auch in einem Prozess, der nach Mt 15,19 im Herzen beginnt” 40.
Joachim Gnilka macht hier eine entscheidende Beobachtung: „Der Zorn aber ist nicht einklagbar, sogar nach außen nicht immer erkennbar. Das Gericht, von dem jetzt die Rede ist, ist nicht mehr ein weltliches, sondern das göttliche“ 41. Fiedler unterstreicht dies: „Wut und Zorn lassen sich ebenso wenig gerichtlich verbieten wie ‚gewöhnliche’ Schimpfwörter […]. Jesu Lehre [zielt] auf eine andere Ebene als die der Rechtsprechung“ 42.
Der biblische Hintergrund ist den Kommentatoren ebenfalls wichtig. Gnilka weist darauf hin: „Weil schon dem AT der Zusammenhang von Zorn und Totschlag bekannt war (vgl. Sir 22,24) und dieser Zusammenhang nichts weiter ist als Erfahrbares“ 43. Maier aus dem HTA-Kommentar präzisiert: „Jesus hat hier nicht ‚freihändig’ formuliert. Er griff vielmehr Lev 19 auf […], wo es in V. 17 heißt: ‚Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen.’“ 44. Rienecker bringt hierzu das Beispiel: „Die Geschichte Kains und Abels gibt ein typisches Beispiel, wie sich der Mord aus Zorn und Haß entwickelt (1. Mose 4)“ 45.
Die Anatomie des Zorns: Was Jesus wirklich meint
Was ist also dieser Zorn konkret? Rienecker fächert die Bedeutung detailliert auf: „Nach innen hin gesehen, ist ‚zürnen’ verbittert sein, erbittert sein auf den Bruder, innerlich erregt sein, Groll in sich tragen, sich vom Bruder zurückziehen, sich von ihm geschieden halten, sich innerlich verzehren.“
„Nach außen hin bedeutet ‚zürnen’ aufgeregt sein, aufbrausen, anfahren, hart sein, ungerecht sein, unfreundliche Gesinnung an den Tag legen, jähzornig werden“ 46. Er fasst zusammen: „Das ist alles Mord am Bruder“ 47. Und weiter: „Jedes Verärgertsein, das im Herzen weiterfrißt, ist Mord am Bruder“ 48.
Ein textkritisches Detail ist an dieser Stelle wichtig: „Die Geschichte der Textüberlieferung ist wie ein Spiegel des menschlichen Herzens. Die weitaus größere Zahl der Handschriften setzt nämlich ein: ‚ohne Grund’, so daß jetzt die viel mildere Aussage entsteht: ‚Jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt.’ Doch blieb die Änderung nicht verborgen. Gott hat dafür gesorgt, daß sein Wort im ursprünglichen Sinne erhalten blieb“ 49. Gnilka bestätigt das: „Das Wörtchen ist sicher nicht ursprünglich“ 50.
Die Radikalität dieser Forderung macht Maier deutlich: Hat Jesus recht mit seiner Auslegung, „dann sind alle Juden, die so stolz auf die Seltenheit von Mordtaten waren, am 5. Gebot schuldig. Dann trifft er auch den abendländischen Stolz an der Wurzel“ 51. Gnilka bemerkt zur Bruderschaft: „Nicht zufällig wird der Brudername eingebracht, der bei Mt das Gemeindemitglied, auf einer vorausliegenden Stufe den Volksgenossen bezeichnet“ 52. Fiedler präzisiert jedoch: „Als Opfer von Zorn und Wut […] nennt Mt den ‚Bruder’ und (selbstverständlich auch) ‚die Schwester’, also Gemeindemitglieder“ 53, während Maier aus dem HTA warnt, dass „Vorsicht […] geboten [ist] gegenüber einer zu engen Auslegung des Begriffes Bruder“ 54.
Vom Herzen zur Zunge: Das verletzende Wort
Jesus zeigt nun, wie aus dem zornigen Herzen das giftige Wort hervorbricht. Fiedler überschreibt diesen Abschnitt daher mit „Die Achtung der Ehre der Anderen“ 55.
Stufe 1: Das verachtende Wort „Raka“
„Wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka!, soll dem Hohen Rat verfallen.“ Maier erklärt die Steigerung: „War vorher vom Zorn allein die Rede, so kommt es jetzt zum Schimpfwort. Die Äußerung des Unmuts ist insofern schlimmer, als der Bruder mit der Zunge verletzt wird“ 56.
Über das Wort „Raka“ geben die Kommentatoren verschiedene Details. Maier erklärt: „‚Raka’ (auf der letzten Silbe betont) bildet wie ‚Amen’ ein aramäisches Fremdwort im Evangelium. Matthäus hat es nicht ins Griechische übersetzt, vielleicht weil er es für unübersetzbar hielt oder weil er dachte, im Osten sei das Schimpfwort auch den Griechischsprechenden bekannt“ 57. Gnilka gibt zudem einen wichtigen lokalen Hinweis: „Die ungewöhnlich erscheinende Vokalisation Raka für das aramäische Schimpfwort Reka (= Dummkopf, Trottel) ist syrisch” 58, was als „örtliches Indiz” nach Syrien weise 59. Rienecker übersetzt es daher mit „Hohlkopf, der gehört nicht zu uns“ 60.
Inhaltlich beschreibt Maier „Raka“ als „Ausdruck der Geringschätzung“, aber „an sich ein harmloses Schimpfwort entsprechend unserem ‚Esel’. Fachleute nennen es das gebräuchlichste Schimpfwort in der Heimat Jesu“ 61. Maier aus dem HTA zitiert Jeremias: „‚ein Ausdruck der ärgerlichen Geringschätzung, die mit Unwillen, Zorn oder Verachtung gepaart sein kann, und wird regelmäßig gegenüber einem törichten, gedankenlosen oder anmaßenden Menschen angewandt. Man empfand das Schimpfwort als harmlos: Schafskopf, Esel.“62
Trotz der scheinbaren Harmlosigkeit stellt Jesus es unter das Urteil des „Hohen Rates“. Maier erklärt: „Um so erstaunter mußten die Hörer sein, wenn Jesus die Sache für so schwerwiegend erklärte, daß der ‚Hohe Rat’, also der Oberste Gerichtshof, zuständig ist“ 63. Denn der „Hohe Rat“ ist „das höchste jüdische Gericht zur Zeit Jesu, das ihn dann später zum Tod verurteilte (Mt 26,57ff.)“ 64. Folglich „kann hier nur die Todesstrafe sein“ 65.
Stufe 2: Das verdammende Wort „Narr“
„Wer aber sagt: Du Narr!, soll der Feuerhölle verfallen.“ Hier erreicht die böse Gesinnung ihren Höhepunkt. Bei der Deutung des Wortes „Narr“ zeigen die Kommentatoren unterschiedliche Ansätze.
Maier gibt zwei Möglichkeiten an: „Entweder hat Matthäus hier ein aramäisches Schimpfwort – Schotja – übersetzt, das ähnlich wie Raka sehr verbreitet war, oder das griechische Wort für ‚Narr’ ist die Wiedergabe für den ‚Toren’ der Weisheitsliteratur. Im ersten Fall hieße es soviel wie ‚Idiot’, wäre also ein spürbar heftigeres Schimpfwort als ‚Raka’. Im zweiten Fall bedeutet es sogar den Ausdruck der Gottlosigkeit und Verdammungswürdigkeit (vgl. Ps 14, 1; 53, 1; Spr 9, 13ff.)“ 66.
Rienecker übersetzt beispielsweise: „du Narr, d. h. du Gottloser, du gehörst in die Hölle“ 67. Spurgeon macht den Unterschied deutlich: Einen Mann „‚Raka’ oder ‚Taugenichts’ zu nennen, heißt seinen Ruf töten, und zu ihm sagen: ‚Du Narr!’ heißt ihn hinsichtlich der edelsten Vorzüge des Menschen töten“ 68.
Maier aus dem HTA weist darauf hin, dass „μωρός [mōros] an mehreren Stellen der LXX Übersetzung für נָבָל [nābāl]“ ist, „was den Gottlosen bezeichnet“ 69. Fiedler zitiert aus der jüdischen Tradition: „Wenn jemand seinen Nächsten öffentlich beschämt, ist es ebenso, als würde er Blut vergießen“ 70.
Die Frage nach einer Steigerung beschäftigt die Kommentatoren dabei durchaus. Gnilka meint: „Zwischen Raka und Tor läßt sich kaum eine Steigerung in der Bosheit ausmachen“ 71. Maier aus dem HTA ist unentschieden: „Es ist dann unerheblich, ob zwischen den beiden Beispielen des Mt ein Unterschied angenommen wird […] oder nicht“ 72. Fiedler betont das gemeinsame Anliegen: „Die Drohung mit dem Hohen Rat und der Feuerhölle will nämlich nur deutlich machen, dass solche Schimpfwörter einem Mord gleichzusetzen sind“ 73.
Die letzte Konsequenz: Das Gericht der Feuerhölle
Die „Feuerhölle“ (Gehenna) hat eine besondere Geschichte, die mehrere Kommentatoren ausführlich erklären. Maier beschreibt sie so: „‚Gehenna des Feuers’ […] ist eine griechische Abwandlung des hebräischen und aramäischen ‚Ge-Hinnom’, das ein Trockental im Süden Jerusalems bezeichnet (Jos 15, 8; 18, 16; 2. Kö 16, 3; 23, 10). Die Könige Ahas und Manasse opferten dort ihre Söhne dem Götzen Moloch durch den Feuertod (2. Kö 16, 3; 21, 6)“ 74.
Gnilka ergänzt die prophetische Dimension: „Jeremia weissagte darum, daß gerade hier auch das Verderben hereinbrechen werde, ein schlimmes Blutbad, bei dem viele umkommen werden (Jer 7,3ff; 19,5ff). Daran knüpft die apokalyptische Erwartung an, daß im Hinnomtal die Gottlosen versammelt werden, damit sie gerichtet werden“ 75.
Die theologische Bedeutung fasst Maier zusammen: „Die Gehenna nimmt sie nach dem Endgericht mitsamt ihrer Leiblichkeit auf, also endgültig. Ewiges Feuer ist dort ihre Strafe für Seele und Leib (Mk 9, 43ff.; Matth 10, 28; vgl. Jak 3, 6)“ 76. Er unterscheidet dabei: „Die Gehenna ist vom ‚Hades’ zu unterscheiden […]. Der Hades nimmt die Gottlosen ohne ihren Leib im Zwischenzustand bis zum Endgericht auf, also nur vorläufig“ 77.
Bei der Frage nach der Gerichtssteigerung gibt Gnilka zu bedenken: „Vermutlich aber denkt Mt, wie schon seine Vorlage, beim Gericht an das göttliche Endgericht, da er auch sonst das Wort κρίσις so gebraucht (10,15; 11,22.24; 12,36.41f; 23,33)“ 78.
Die tiefere Bedeutung: Was Jesu Auslegung für uns heißt
Die Botschaft Jesu trifft uns somit bis ins Mark. Maier bringt es auf den Punkt: „An dieser Stätte ewiger Qual und Verdammnis sieht Jesus also den, der durch ein böses Wort den Bruder verletzt – weil er dadurch am 5. Gebot schuldig wurde“ 79. Rienecker formuliert die Herausforderung: „Ein sehr ernstes Wort Jesu, das bis in die letzten Winkel unseres Herzens hineinleuchtet und uns fort und fort richtet und läutert“ 80. Denn „sein Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens (Hbr 4,12)“ 81.
Gnilka erklärt die eigentliche Spitze: „Selbstverständlich bleibt das Verbot des Dekalogs bestehen. Aber es muß ausgeweitet werden zu einem brüderlichen Verhältnis der Menschen untereinander“ 82. „Die Spitze der Antithese [ist] in einer Korrektur gesetzlichen Denkens zu suchen“ 83.
Fiedler betont die praktische Dimension: „Solche ‚Selbstbeherrschung’ […] mutet uns Jesus im Zeugnis des Mt zu, und zwar nicht, um unsere asketischen Fähigkeiten zu testen, sondern um durch gegenseitige Versöhnungsbereitschaft und Achtung der Menschenwürde […] zu humane(re)n Lebensverhältnissen beizutragen“ 84.
Luther wird von Rienecker schließlich mit einem drastischen Wort zitiert: „So manch Glied du hast, so mancherlei Weise du finden magst zu töten, es sei mit der Hand, Zunge, Herzen oder Gebärden, sauer ansehen mit den Augen […] wenn du nicht gern hörst von ihm reden: das alles heißet ‚töten’. Denn da ist Herz und alles, was an dir ist, so gesinnet, daß es wollte, er wäre schon tot“ 85.
Ein Urteil – und ein Ausweg
Jesus hält uns damit einen radikalen Spiegel vor: Der Mord beginnt nicht mit der Tat, sondern im Herzen, das in Zorn und Verachtung verharrt. Doch er belässt es nicht bei dieser tiefgreifenden Diagnose, die uns alle schuldig spricht, sondern zeigt sofort den praktischen Weg zur Vergebung auf! (Mt 5,23–26)
Aber noch mehr unterstreicht es die herausfordernde Aussage aus Vers 20: „Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen.“ Wie gut, dass das Matthäus-Evangelium nicht bei den hohen Ansprüchen der Bergpredigt in Kapitel 5–7 endet. Das Evangelium gipfelt im Tod und der Auferstehung des einen, dessen vollkommene Gerechtigkeit nicht nur der besten Menschen übertrifft, sondern auch für Gottes heilige Ansprüche ausreicht. Eine Gerechtigkeit, die er nicht für sich behält, sondern mit uns zornigen und unversöhnlichen Menschen teilt.
Bibliografie
Fiedler, P. (2006) Das Matthäusevangelium. Herausgegeben von E.W. Stegemann u. a. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH (Theologischer Kommentar zum Neuen Testament), S. 129–135.
Gnilka, J. (1986–1988) Das Matthäusevangelium. Sonderausgabe. Herausgegeben von J. Gnilka und L. Oberlinner. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament), S. 150–155.
Kühlein, D. (2022) Matthäus. bibletunes.de; Faithlife (Die Bibel für Kopf und Herz (Der bibletunes-Kommentar)), S. Mt 5,21–26.
Maier, G. (2007) Matthäus-Evangelium. Herausgegeben von G. Maier. Holzgerlingen: Hänssler (Edition C Bibelkommentar Neues Testament), S. 151–156.
Maier, G. (2015) Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 1–14. Herausgegeben von G. Maier u. a. Witten; Giessen: SCM R.Brockhaus; Brunnen Verlag (Historisch-Theologische Auslegung Neues Testament), S. 294–311.
Remmers, A. (2019) Die Bergpredigt: Eine Verständnishilfe zu Matthäus 5–7. überarbeitet. Hückeswagen: CSV, S. Mt 5,21–26.
Rienecker, F. (2018) Das Evangelium des Matthäus. Herausgegeben von F. Laubach, A. Pohl, und C.-D. Stoll. Holzgerlingen: SCM R. Brockhaus (Wuppertaler Studienbibel), S. 86–89.
Spurgeon, C.H. (2020) Das Evangelium des Reiches. 2. Auflage der Neuausgabe. Augustdorf: Betanien, S. 56–58.
Fußnoten
- Kühlein (2022) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Kühlein (2022) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Maier (2015) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Remmers (2019) ↩
- Remmers (2019) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Kühlein (2022) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Spurgeon (2020) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Maier (2015) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Maier (2015) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Maier (2015) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2015) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2015) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Spurgeon (2020) ↩
- Maier (2015) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Maier (2007), Bd. 1 ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Rienecker (2018) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Gnilka (1986–1988) ↩
- Fiedler (2006) ↩
- Rienecker (2018) ↩