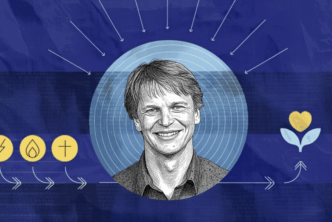Englisches Original: Rebekah Eklund
Deutsche Übersetzung: Dorothea Weiland
Das wohl schwierigste Gebot, das Jesu uns jemals gegeben hat, ist das Gebot, unsere Feinde zu lieben (Mt 5,43–48; Lukas 6,27–36).
Was bedeutet es, in diesem Kontext zu „lieben“? Wer ist denn mein Feind? Warum hat Jesus seinen Nachfolgern geboten, ihre Feinde zu lieben und wie kann das ganz praktisch aussehen?
Inhalt
- Das Gebot der „Feindesliebe“ in seinem Kontext
- Die Bergpredigt im Matthäusevangelium (Mt 5,43–48)
- Jesu Feldrede im Lukasevangelium (Lk 6,27–36)
- Feindesliebe als Form der Nachfolge
- Was bedeutet es, unsere Feinde zu lieben?
- Was bedeutet es, zu „lieben“?
- Wie kann Feindesliebe ganz praktisch aussehen?
Das Gebot der „Feindesliebe“ in seinem Kontext
Das Gebot, seine Feinde zu lieben, taucht in den Evangelien an zwei Stellen auf: im Matthäusevangelium und bei Lukas. Schauen wir uns die beiden Stellen etwas genauer an.
Die Bergpredigt im Matthäusevangelium (Mt 5,43–48)
Im Matthäusevangelium wird das Gebot der Feindesliebe im Zusammenhang mit der Aussage Jesu, er sei nicht gekommen, das Gesetz (die Tora) bzw. die Propheten aufzuheben, sondern sie zu erfüllen (Mt 5,17). Das Gebot selbst folgt unmittelbar auf die sogenannten „Antithesen“. Damit sind die Aussagen Jesu gemeint, die mit „Ihr habt gehört, dass [zu den Alten] gesagt ist … Ich aber sage euch …“ (Mt 5,21–48).
Nach „Ihr habt gehört, dass gesagt ist“, zitiert Jesus jeweils ein Gebot aus dem Gesetz des Mose, der Tora. Wenn er dann mit „Ich aber sage euch“ fortfährt, setzt er das jeweils genannte Gebot nicht außer Kraft. Stattdessen weitet er es aus oder verleiht ihm sogar größere Tiefe, indem er die Herzenshaltung anspricht, die ggf. dazu führt, dass jemand das genannte Gebot bricht.
Ein Beispiel: Das Gebot „Du sollst nicht töten“ impliziert auch, dass man dem Zorn und der Wut im Herzen keinen Raum gibt, die letztendlich nur zu Hass und in letzter Instanz zu dem Wunsch führen, den anderen zu töten.
Das Gebot, die Feinde zu lieben ist das letzte in der Reihe der sechs Antithesen. Es unterscheidet sich von den vorherigen fünf, in denen Jesus zuerst kurz das Alte Testament zitiert und dann eine Aussage anhängt, die nicht im Alten Testament zu finden ist.
Das Gebot „Liebe deinen Nächsten“ (Mt 5,43) ist ein Zitat aus Levitikus 19,18. Aus anderen Versen in Levitikus 19 erfahren wir, dass „der Nächste“ als Teil „deines Volkes“ (Lev 19,16) und als „Bruder“ (Lev 19,17) definiert wurde.
Am Ende des Kapitels wird das Konzept des „Nächsten“ sogar auf Fremde/Ausländer angewandt, die unter den Israeliten lebten: „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst“ (Lev 19,33–34; LUT17).
In Matthäus macht Jesus daraus Folgendes: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist … und deinen Feind hassen“ (Mt 5,43). Das ist seltsam. Denn in der Tora wird den Israeliten an keiner Stelle geboten, ihre Feinde zu hassen.
Möglicherweise haben einige Israeliten aus dem Gebot „Liebe deinen Nächsten“ geschlossen, dass das Gegenteil dazu ebenfalls wahr ist: Hasse deine Feinde – insbesondere diejenigen, die eine Bedrohung für Israel darstellen. Jesus bejaht den ersten Teil dieser Aussage („Liebe deinen Nächsten“), verneint aber die zweite Hälfte („Hasse deine Feinde“).
Wer ist denn mein Nächster?
Für Jesus ist jeder der Nächste – ohne Ausnahme. Und gemeint sind besonders diejenigen Menschen, die man gar nicht lieben möchte oder bei denen es uns schwer fällt. Es geht hier nicht um die eigenen Landsleute in Israel. Oder um die Leviten. Auch nicht um die Fremdlinge im Land, die sich unter den Israeliten angesiedelt haben.
Es geht um die Außenseiter. Um die Syrer, Assyrer und die Babylonier. Also auch um die Leute, die die Israeliten verfolgten. Die ihnen schaden wollten. Und um die verhassten Römer, die die Israeliten zur Zeit Jesu schwer unterdrückten.
Für Jesus ist jeder der Nächste – ohne Ausnahme. Und gemeint sind besonders diejenigen Menschen, die man gar nicht lieben möchte oder bei denen es uns schwer fällt.
Direkt nach dem Gebot der Feindesliebe gibt Jesus Anweisungen zum Fasten, zu Almosen und zum Gebet. Dabei handelt es sich um die drei Säulen des jüdischen Glaubens und der Anbetung. Jesus erwartet von seinen Nachfolgern nicht nur, dass sie diese Anordnungen befolgen, sondern dass sie aus ihrer inneren Herzenshaltung heraus handeln (Mt 6,1–21).
Die Anweisungen Jesu hinsichtlich des Betens (darunter auch das Vaterunser) geben einen Hinweis darauf, wie das Gebot der Feindesliebe in die Tat umgesetzt werden könnte: Mithilfe der Gnade Gottes. Ohne Gottes Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen ist es unmöglich, unsere Feinde zu lieben. Unsere Fähigkeit, zu vergeben, ergibt sich daraus, dass wir selbst erkennen, wie viel Gott uns vergeben hat (Mt 6,12; siehe auch Lk 7,47).
Jesu Feldrede im Lukasevangelium (Lk 6,27–36)
Im Lukasevangelium steht das Gebot Jesu, die Feinde zu lieben (Lk 6,27–36) direkt hinter den Seligpreisungen („Selig sind die Armen) und den Weherufen „Weh euch Reichen“, Lk 6,20–26). Dieser Kontext zeigt auf subtile Art und Weise, dass sich Arme und Reiche gegenseitig nicht verachten sollen. Die Warnungen an diejenigen, die sich satt essen können geben den Hungrigen nicht das Recht, sie zu hassen. Und die Reichen dürfen nicht voller Verachtung auf die Armen herabblicken.
Ein paar Kapitel später erzählt Jesus ein Gleichnis, das die Bedeutung des Gebots „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Lk 10,27) noch einmal näher erläutert. Ein Schriftgelehrter wollte Jesus eine Falle stellen und sich selbst rechtfertigen. Deshalb fragte er ihn: „Wer ist denn mein Nächster?“ (Lk 10,28). Jesus antwortet ihm mit der Geschichte über einen Samariter – aus der Perspektive der Juden, die sich an die Tora hielten, einen der „Anderen“ oder Ausländer. Und dieser Ausländer ist derjenige, der das Gebot der Nächstenliebe erfüllt. Der „Nächste“ ist in diesem Fall ein Fremder, den er nicht kennt, aber der dennoch eindeutig Hilfe braucht.
Jesus dreht die Frage des Schriftgelehrten komplett um: Die Frage lautet nicht: „Wer ist denn mein Nächster?“ (als ob man selbst auswählen könnte, wer dazugehört und wer nicht), sondern: „Wie kann ich für jemanden, der Hilfe braucht, zum Nächsten werden?“ In diesem Fall ist derjenige, der zuerst als Feind betrachtet wurde, derjenige, der zeigt, was es bedeutet, jemanden zu lieben. Der Schriftgelehrte erkennt richtigerweise: Der Nächste (sein Feind?) ist derjenige, der Barmherzigkeit gezeigt hat (Lk 10,37).
Starten Sie Ihr persönliches Bibelstudium zu Mt 5,43–48 und Lk 6,27–36 mit dem Faktenbuch in Logos
Feindesliebe als Form der Nachfolge
Die Betonung der Barmherzigkeit führt uns wieder zurück zum Gebot der Feindesliebe.
Im Lukasevangelium spiegelt diese Liebe die Liebe Gottes wider. Die Zusammenfassung des Abschnitts über das Gebot der Feindesliebe schließt mit der Anweisung Jesu: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36). Seine Feinde zu lieben ist also eine Form der Barmherzigkeit und Gnade, die die göttliche Gnade widerspiegelt. Denn Gott ist auch „gütig gegen die Undankbaren und Bösen“ (Lk 6,35).
Dasselbe findet sich auch bei Matthäus (siehe Mt 5,45), hier jedoch mit einer anderen Wendung. Im Matthäusevangelium schließt Jesus den Abschnitt zur Feindesliebe mit der Anweisung „Seid vollkommen wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist“ ab (Mt 5,48).
Das Wort, das hier im Griechischen für „vollkommen“ verwendet wird, ist τέλειος. Es bedeutet „vollkommen, vollständig oder reif. Der Punkt, den Matthäus hier macht, ist jedoch derselbe wie bei Lukas. Die Feinde zu lieben spiegelt Gottes vollkommene Liebe wider, die keinen Unterschied macht (Mt 5,48). Gott lässt es regnen und die Sonne scheinen (zwei gute Gaben, die dem Leben dienen) – und zwar auf Gerechte und Ungerechte (5,45).
Wir wissen, dass Gott selbst seine Feinde liebte, denn Jesus starb für uns als wir selbst noch Sünder und weit weg von Gott waren (Römer 5,8). Genauso sollen auch die Kinder Gottes diejenigen lieben, die diese Liebe verdienen und auch diejenigen, die sie nicht verdienen – also Freund und Feind.
Was bedeutet es, unsere Feinde zu lieben?
Wer ist denn mein Feind?
Ein Feind ist nicht einfach nur jemand, der nicht unserer Meinung ist. Feinde versuchen, diejenigen zu zerstören, mit denen sie nicht einer Meinung sind. Jesus verwendet den Ausdruck „die euch verfolgen“, „die euch hassen“ und „die euch beleidigen“ als Synonym für „Feind“ (Mt 5,44; Lk 6,27, 28).
Vielleicht haben Sie persönliche Feinde. Jemanden, der darauf aus ist, Ihnen zu schaden oder Sie zu unterdrücken. Das kann beispielsweise ein Arbeitskollege sein, der Ihren guten Namen in den Dreck zieht. Oder ein Mitglied Ihrer Familie, der Sie immer wieder absichtlich verletzt oder ein Freund, der sich plötzlich gegen Sie stellt. Wie schmerzhaft ist es, wenn plötzlich eine Beziehung zu einem Freund oder zu jemandem aus der eigenen Familie nicht mehr harmonisch ist, sondern von Zwietracht geprägt ist.
Vielleicht kennen Sie aber auch niemanden, den Sie als Ihren persönlichen Feind bezeichnen würden. Aber sicher fällt Ihnen jemand ein, der ein Feind des Evangeliums ist. Das kann eine Person aus der Öffentlichkeit sein, die sich Ihnen gegenüber schädlich verhält, oder auch Menschen aus der Nachbarschaft oder aus Ihrer Gemeinde.
Bei solchen Menschen handelt es sich in einem allgemeineren oder abstrakten Sinn um Feinde. Jemand, der Zwietracht und Feindschaft sät, statt Frieden (Shalom) und Versöhnung. Jemand, der Dinge oder Beziehungen kaputt macht, statt aufzubauen.
Ein neuer Blick auf Feinde
Doch trotzdem gilt: Auch unsere Feinde sind Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden (Gen 1,26–27). Sie sind Menschen, die Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie sterben ließ (Joh 3,16), damit sie und Gott nicht länger in Feindschaft leben, sondern in einer von Versöhnung geprägten Beziehung (2 Kor 5,19).
Es kann extrem herausfordernd sein, seinen Feind als Person zu betrachten, die von Gott geliebt wird und die nach Gottes Bild geschaffen wurde. Eine Person, für die Christus gestorben ist. Das ist der Gedankensprung, den Jesus seinen Jüngern abverlangt, wenn er Ihnen gebietet, ihre Feinde zu lieben. Es ist ein Aufruf zum Widerstand, selbst für jemand anderen zum Feind zu werden.
Klar, das Ebenbild Gottes kann in einer feindseligen Person bis zur Unkenntlichkeit verwischt oder verzerrt sein. Es ist hilfreich, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, dass Gottes Ebenbild in uns allen verzerrt und ganz und gar unvollkommen ist. Wie bereits der Apostel Paulus sagte: Alle Menschen haben ohne Ausnahme gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Keiner von uns hat eine Ausrede dafür, sich über andere zu erheben oder mit den eigenen Erfolgen anzugeben (Römer 3,10–24, 27–30).
Was bedeutet es, zu „lieben“?
Die Art der Liebe (ἀγάπη (agapē)), die Jesus von uns als seinen Nachfolgern erwartet, ist dieselbe hingebungsvolle Liebe, die er in seinem Leben und seinem Tod erwiesen hat (siehe z. B. Phil 1,1–8; Kol 3,13). Auf diese Weise zu lieben, bedeutet, das Gute für den Anderen zu suchen und alles dafür zu tun, dass dieses Gute auch geschieht.
Das Gute für unsere Feinde zu suchen, bedeutet nicht, die Gerechtigkeit aufzugeben. Genauso wenig wie Gottes unterschiedslose Liebe bedeutet, dass Gott nicht über das Böse richtet. Gottes Gerechtigkeit verlangt Rechenschaft von all denjenigen, die in der Welt Unheil anrichten, Gottes Gebote missachten und sich gegen Gottes gute Absichten für die Welt auflehnen (1 Kor 15,24–26).
Liebe ist eine Entscheidung, auf unser Recht auf Rache zu verzichten. Es ist eine Entscheidung, aktiv zu versuchen, unseren Zorn und unsere Bitterkeit zu überwinden.
Das Gute für einen Feind zu suchen, kann z. B. bedeuten, zu hoffen und zu beten, dass sie sich vom Unrecht abwenden und Buße tun. Dass sie vom Zorn zum Mitgefühl kommen. Es kann auch bedeuten, zu verstehen, wie Menschen in Abhängigkeiten oder Systeme geraten, die größer sind als sie selbst. Oder dass destruktives Handeln manchmal aus tiefen Wunden in der Vergangenheit oder Gegenwart herrührt.
Das Mindestmaß ist – laut Paulus: „Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses“ (Römer 13,10). Das gilt sowohl für unsere persönlichen Begegnungen als auch für unsere Aktivitäten in den Sozialen Medien.
Als Martin Luther King Jr. Eine Predigt zum Thema Feindesliebe hielt, zeigte er auf, dass wir unsere Feinde nicht mögen müssen, um sie lieben zu können. Es geht nicht um warme Gefühle. Liebe ist eine Entscheidung, auf unser Recht auf Rache zu verzichten. Es ist eine Entscheidung, aktiv zu versuchen, unseren Zorn und unsere Bitterkeit zu überwinden. Das kann im Gebet geschehen, in der Seelsorge oder bei jemandem, bei dem man Rechenschaft ablegen kann. Oder in einer Kleingruppe.
Wie kann Feindesliebe ganz praktisch aussehen?
Wie kann diese Liebe ganz praktisch aussehen?
Es gibt eine Version von Martin Luther Kings Predigt zur Feindesliebe, in der er vorschlägt, dass wir zuerst auf uns selbst schauen sollen:
- Habe ich irgendetwas getan, das meinen Feind dazu gebracht hat, mich zu hassen?
- Kann ich irgendetwas tun, um Wiedergutmachung zu leisten oder – selbst wenn ich nichts falsch gemacht habe – einen ersten Schritt zur Versöhnung tun?
Martin Luther King besteht zudem darauf, dass wir wenigstens eine gute Eigenschaft an unserem Feind finden müssen. Egal wie schwer uns das auch fallen mag. Wir wurden alle von Gott nach seinem Ebenbild geschaffen. Wenn ich es Gott wert war, erlöst zu werden, dann ist es mein Feind auch.
Der Apostel Paulus nimmt die Lehren Jesu auf, wenn er seine Brüder und Schwestern in Christus dazu auffordert, ihre Verfolger zu segnen und für sie zu beten (Mt 5,44; Römer 12,14; siehe auch 1 Petr 3,9). Wirklich aufrichtig für seine Feinde zu beten, kann heißen, darum zu bitten, dass ihr Herz weich wird und sie zur Buße kommen. Es kann auch bedeuten, Gott darum zu bitten, ihre Wunden zu heilen oder in aller Ernsthaftigkeit für ihre Errettung einzutreten. Solche Gebete landen direkt im Thronsaal Gottes. Und sie können Schritt für Schritt auch unser Herz verändern.
Paulus schreibt zudem in Römer 12,17, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen. Selbst wenn uns jemand verletzt oder uns Böses antut, sollen wir es ihm nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Stattdessen sollen wir das Böse mit Gutem überwinden (12,21).
Böses wird nie mit noch mehr Bösem überwunden.
Sondern nur mit Liebe.