Wir erleben gerade eine Generation, die in einer völlig neuen Welt aufwächst: Die Generation Z.
Sie kennt kein Leben ohne Internet, ohne permanente Verfügbarkeit von Informationen, ohne soziale Medien. Der ständige Strom aus News, Clips, Storys und viralen Trends formt ihre Wahrnehmung – schnell, flüchtig, visuell.
Was zählt, ist das Neue. Was nicht im Feed erscheint, wird leicht vergessen. Vergangenes wirkt oft irrelevant – oder höchstens dann spannend, wenn es sich in ein 15-sekündiges Reel verpacken lässt. In dieser digitalen Dauerbeschallung ist es eine gewaltige Herausforderung, sich mit etwas zu beschäftigen, das alt ist, komplex – und nicht sofort Aufmerksamkeit garantiert: mit Geschichte. Und erst recht mit Kirchengeschichte. Aber genau das brauchen wir: Denn wer Gottes Handeln in der Vergangenheit nicht kennt, verpasst, ihn im Heute zu erkennen. Wer nicht weiß, woher der christliche Glaube kommt, kann kaum verstehen, warum er heute so aussieht, wie er aussieht – geschweige denn, wohin er führen kann.
„Gott! Mit unseren Ohren haben wir es gehört! Unsere Vorfahren haben es uns erzählt: Großes hast du getan in ihren Tagen, damals, vor langer Zeit.“ – Psalm 44,2
Die Kirche lebt nicht vom Trend, sondern vom treuen Handeln Gottes in Raum und Zeit. Kirchengeschichte ist nicht bloß ein Rückblick – sie ist eine Entdeckung seiner bleibenden Gegenwart.
Inhalt
Warum Kirchengeschichte studieren?
Zu Recht fragen sich viele Christen, Theologiestudierende und Geistliche, ob sich das Studium der Geschichte überhaupt lohnt. Im Gespräch mit Armin Sierszyn haben wir herausgefunden: Und ob! Das Studium der Geschichte hat enorm viele Vorteile.
„Die Zukunft ist die Summe der Vergangenheit. Wer geschichtslos lebt, wird die Zukunft weniger gut mitgestalten können. wer nicht weiss, woher er kommt, weiss auch nicht, wohin er geht.“ – Autor unbekannt
Natürlich haben wir außer einem schlauen Zitat noch weitere Argumente im Köcher. Als Hinführung und Einleitung möchte ich Ihnen nun sechs Gründe dafür geben, warum Sie die Geschichte der Kirche kennenlernen sollten.
-
Die Kirche ist ein Werk Gottes in der Geschichte.
Die Kirchengeschichte bezeugt die Treue Gottes gegenüber seinem Volk. Trotz Verfolgung, innerer Spannungen und zahlreicher Herausforderungen hat die Kirche überlebt und sich ausgebreitet – nicht aufgrund menschlicher Kraft, sondern durch das Wirken Gottes (vgl. Mt 16,18). Das Studium der Kirchengeschichte weckt Staunen über Gottes Handeln in Raum und Zeit. -
Kirchengeschichte dient der Apologetik.
Eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kirche stärkt die Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses. Sie hilft uns, sowohl Licht als auch Schatten zu benennen. Christen müssen bereit sein, Schuld anzuerkennen – sei es in den Kreuzzügen, in konfessionellen Kriegen oder anderen Formen, in denen der Glaube zugunsten eigener Ziele missbraucht wurde. Gott bleibt heilig und wahr, auch wenn seine Kirche versagt. -
Aus der Geschichte lernen wir.
Die Bibel selbst verweist auf die Bedeutung der Geschichte für die Gegenwart (vgl. Ps 44,2; 1 Kor 10,11; Apg 7). Historische Rückschau hilft, geistliche Prinzipien zu erkennen, Fehler nicht zu wiederholen und Gottes Wirken in vergangenen Generationen als Ermutigung für heute zu verstehen.
Weitere Gründe
-
Kirchengeschichte ist geistliche Familiengeschichte.
Wer an Christus glaubt, gehört zur weltweiten Gemeinschaft der Heiligen – über alle Zeiten hinweg. Die Geschichte der Kirche ist auch unsere Geschichte. Sie erinnert uns daran, dass der Glaube, den wir heute leben, durch das Zeugnis vieler Glaubensgeschwister weitergegeben wurde. -
Kirchengeschichte erweitert den Horizont.
Sie zeigt die Vielfalt christlicher Praxis und Theologie in unterschiedlichen Kulturen und Zeiten. Unterschiedliche Formen etwa des Abendmahls oder der Kirchenordnung entspringen oft derselben biblischen Grundlage, aber unterschiedlichen geschichtlichen Entwicklungen. Das fördert Demut, Respekt und ökumenische Sensibilität. -
Kirchengeschichte führt zur Anbetung.
Die Rückschau auf Gottes Wirken durch schwache Menschen vertieft unsere Ehrfurcht und Dankbarkeit. Sie lässt uns Gottes Gnade, Geduld und Macht neu erkennen – und ruft uns dazu auf, ihn zu loben für seine unerschütterliche Treue durch alle Jahrhunderte hindurch.
Ich hoffe, diese Gründe zeigen die Relevanz auf, warum man sich mit Geschichte beschäftigen sollte. Heute möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise ins Urchristentum, wo Gottes Größe besonders sichtbar wurde.
„Die 2000-jährige Geschichte der Kirche ist reich an Bösem, das mehr oder weniger fromme Menschen einander im Namen Gottes antun“. – Armin Sierszyn, 2000 Jahre Kirchengeschichte, S. 5
Wunder und Wunde der Kirche
Die Kirchengeschichte beginnt nicht einfach mit einem historischen Ereignis, sondern mit einer Person: Jesus von Nazareth. Aus einer kleinen Bewegung von Jüngern, die an seine Auferstehung glaubten, entstand eine weltweite Gemeinschaft, die wir heute als Kirche kennen. Was mit ein paar Menschen in Galiläa begann, verbreitete sich über das ganze Römische Reich – und das trotz (oder gerade wegen) enormer Widerstände.
Die Kirchengeschichte erzählt von Menschen, die glaubten, dass Jesus der auferstandene Herr ist, und die bereit waren, dafür alles zu riskieren. Sie ist keine bloße Abfolge von Daten und Namen, sondern die Geschichte von Gottes Wirken durch fehlbare, leidende und glaubende Menschen – über Jahrhunderte hinweg.
Gerade die ersten drei Jahrhunderte sind ein Wunder: Die junge Kirche hatte keine politischen Privilegien, keine finanziellen Ressourcen, keine großen Institutionen – und trotzdem wuchs sie. Sie überlebte Verfolgung, soziale Ächtung, innere Konflikte und theologische Auseinandersetzungen. Warum?
Darum geht es im ersten Teil dieser kleinen zweiteiligen Serie: um das Wunder der Kirche – und warum es überhaupt Kirche gibt.
Die Geburt der Kirche
Die Kirche ist keine menschliche Idee. Sie ist Gottes Idee. Jesus selbst hat sie ins Leben gerufen. Nicht als Institution, sondern als lebendigen Organismus – als Gemeinschaft von Menschen, die ihm nachfolgen. Der Startpunkt liegt irgendwo zwischen den Jahren 29 und 33 n. Chr. Nach seiner Taufe beginnt Jesus, öffentlich zu wirken. Er beruft Jünger, heilt Kranke, predigt vom Reich Gottes – und kündigt an, dass etwas völlig Neues entstehen wird:
„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“ – Matthäus 16,18
Jesus kündigt nicht nur die Geburt der Kirche an – er sichert ihr auch ihr Überleben zu. Ganz gleich, was kommt: Seine Gemeinde wird nicht untergehen. In diesem einen Satz liegt eine gewaltige Zusage – und ein Versprechen, das sich bis heute bewahrheitet hat. Kurz vor seiner Himmelfahrt gibt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag, der alles verändert:
„Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ – Matthäus 28,19–20
Damit ist der Startschuss gefallen: Die Jünger sollen in der ganzen Welt verkündigen, wer Jesus ist, und Menschen in seine Nachfolge rufen. Genau das ist passiert. Und so entstand die Kirche – zunächst unscheinbar, im Schatten des römischen Imperiums. Die ersten Christen trafen sich in Privathäusern (z. B. Apg 2,46), auf Marktplätzen oder im Tempelvorhof, um gemeinsam zu beten, sich gegenseitig zu ermutigen, von Jesus zu erzählen und das Brot zu brechen. Christen wurden für ihre Nächstenliebe bekannt und wurden gewöhnlich für ihre freundliche Art sehr hoch angesehen (Apg 2,41–47). Was damals in Jerusalem begann, breitete sich über ganz Judäa, Galiläa, Syrien, Kleinasien, Griechenland und später Rom aus – bis an die Enden der Erde. Doch nicht für eine lange Zeit waren Christen unter den Völkern beliebt. Ihr Ansehen schrumpfte und es kam definitiv anders!
Warum das Christentum eigentlich keine Chance hatte
Wenn man die Kraft bedenkt, mit der die Kirche ins Leben gerufen wurde, könnte man meinen: Innerhalb von drei Monaten hätte sich doch die ganze Welt bekehren müssen! Immerhin ist es dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat – eine Kraft, die Grenzen überwindet, Mauern einreißt und Herzen verändert.
Doch es kam anders.
Schon ganz früh regte sich Widerstand. Zunächst von jüdischer Seite: Saulus – der spätere Paulus – war ein fanatischer Verfolger der jungen Jesusbewegung. Doch bald wurden auch die römischen Behörden auf die Christen aufmerksam. Und das hatte weitreichende Folgen. Denn das Römische Reich reichte damals von Britannien bis nach Nordafrika, von Spanien bis an den Persischen Golf – und mittendrin: Israel. Die Machtzentrale dieses Weltreiches lag in Rom. Eine Millionenstadt im ersten Jahrhundert – mit Palästen, Tempeln, Märkten und einem eigenen Kaiser, der nicht nur regierte, sondern auch religiös verehrt wurde. Der sogenannte Kaiserkult verlangte von allen Bewohnern des Reiches, dem Kaiser göttliche Ehre zu erweisen – durch Rituale, Opfer und eine öffentliche Loyalitätsbekundung. Man musste sich symbolisch vor seiner Statue verbeugen. Für viele kein Problem. Für Christen ein Unding. Denn Christen glaubten an nur einen Herrn: Jesus Christus. Sie ehrten den Kaiser, zahlten Steuern, beteten für die Regierung – aber sie beteten sie nicht an. Und genau das machte sie verdächtig.
„Denn du sollst dich nicht niederwerfen vor einem anderen Gott, denn Eifersüchtig ist der Name des HERRN, ein eifersüchtiger Gott ist er.“ – Exodus 34,14
Nero: Der erste große Verfolger
Der römische Kaiser Nero regierte von 54–68 n. Chr. und wurde zum ersten, der gezielt Christen verfolgen ließ. Im Jahr 64 n. Chr. brannte Rom – ein Großbrand zerstörte weite Teile der Stadt. Nero brauchte einen Sündenbock. Und er fand ihn in den Christen. Sie seien eine „verhasste Sekte“, hieß es. In grausamen öffentlichen Spektakeln ließ Nero Christen kreuzigen, verbrennen oder wilden Tieren vorwerfen. Auch die Apostel Petrus und Paulus wurden in dieser Zeit in Rom hingerichtet – vermutlich zwischen 60 und 67 n. Chr. unter diesem Kaiser:
„Man kann die Petrus- und Paulustradition in Rom kaum weiter als bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts zurückverfolgen, bei Paulus vielleicht bis in die Zeit um 100. In Würdigung des gesamten Befunds wird man gleichwohl daran festhalten dürfen, dass Petrus und Paulus unter Nero am Kreuz bzw. durch das Schwert hingerichtet wurden.“ – W. Kinzig in Christenverfolgung der Antike
Was machte die Christen so gefährlich in den Augen des Römischen Reiches?
- Sie verweigerten sich dem Kaiserkult, was als politischer Verrat verstanden wurde.
- Sie lehnten alle anderen Götter ab – in einer polytheistischen Gesellschaft galt das als atheistisch und gesellschaftsfeindlich.
- Sie brachten keine Tieropfer dar, sondern glaubten, dass durch das Opfer Jesu ein für alle Mal genug geopfert wurde. Das wirkte fremd.
- Sie predigten, dass jeder Mensch, egal wie schuldig, zu Gott kommen kann – das stellte das ständisch geprägte Weltbild der Römer infrage.
- Manche hielten sie gar für Kannibalen – wegen der symbolischen Sprache des Abendmahls, in dem vom „Leib“ und „Blut Christi“ die Rede war.
Christen wurden zunehmend zur Zielscheibe. Unter Kaiser Domitian (81–96) verschärfte sich die Lage, und ab dem Jahr 100 war es unter gewissen Umständen tödlich, sich öffentlich zu Christus zu bekennen. Es folgten bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts insgesamt acht große Verfolgungswellen unter verschiedenen Kaisern – darunter Trajan, Mark Aurel, Decius, Valerian und Diokletian. Trotz all dieser Angriffe wuchs die Gemeinde. Haus um Haus, Stadt um Stadt.
Niemand konnte das Feuer auslöschen, das in den Herzen der Gläubigen brannte.
Gerade in der Schwachheit, in der Hingabe und im Leiden offenbarte sich eine andere Macht – nicht militärisch, sondern geistlich. Nicht von oben herab, sondern von innen heraus. Die Verfolgung konnte die Kirche nicht zerstören. Im Gegenteil: Sie schärfte ihre Identität, festigte ihren Zusammenhalt – und offenbarte das Wunder ihres Bestehens. Christsein heisst mit Christus zu leiden – Dieses Zitat wird Dietrich Bonhoeffer zugeschrieben. Über solche Erlebnisse können wir heute aus westlicher Sicht im Jahr 2025 nur noch staunen!
Durchhalten bis zum Tod – das mutige Bekenntnis der Christen
Ein einziger Satz hätte genügt.
Ein einziges Lippenbekenntnis, eine kleine Verleugnung – und viele Christinnen und Christen hätten ihr Leben retten können. Doch sie entschieden sich anders. Sie hielten fest an dem, was sie glaubten: Dass Jesus der Herr ist – und niemand sonst. Zur Zeit der römischen Christenverfolgungen bedeutete das Festhalten am Glauben oft den Tod. Es hätte so einfach sein können: ein Schwur auf den Kaiser, eine kleine Geste vor der Statue – und man hätte weiterleben dürfen. Doch viele dachten an Jesu Worte:
„Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen.“ – Matthäus 10,32
Und Gott gab ihnen die Kraft. Sie bekannten sich – mit ihrem Leben.
Polykarp von Smyrna
Ein besonders eindrückliches Beispiel berichtet uns Sierszyn in seinem Buch 2000 Jahre Kirchengeschichte. Es geht um das Martyrium des Bischofs Polykarp von Smyrna. Er lebte in Kleinasien und war um das Jahr 155 n. Chr. bereits ein alter Mann – 86 Jahre alt. Der Kirchenvater Irenäus berichtet, dass Polykarp ein direkter Schüler des Apostels Johannes war. Als in Smyrna Christen in der Arena hingerichtet wurden, forderte das Volk, auch ihren Bischof zu sehen. Polykarp hatte sich zunächst auf einem Landgut versteckt und sich ins Gebet zurückgezogen. Drei Tage vor seiner Gefangennahme hatte er eine Vision: Sein Kopfkissen brannte. Er sagte nur: „Ich muss lebendig verbrannt werden.“
Als man ihn schließlich aufspürte, erschrak er nicht. Stattdessen bat er um eine Stunde zum Gebet – und bewirtete sogar seine Häscher mit einem kleinen Mahl. Dann schleppte man ihn vor den römischen Statthalter. Dieser forderte: „Schwöre, und ich lasse dich frei. Lästere Christus!“ Doch Polykarp antwortete: „86 Jahre diene ich ihm, und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat?“ Der Statthalter drohte weiter – mit wilden Tieren, mit Feuer. Doch Polykarp blieb standhaft: „Du drohst mit Feuer, das nur eine kurze Zeit brennt. Aber du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts. Warum zögerst du? Tu, was du willst!“ – Polykarp von Smyrna
Das Volk tobte. Es schichtete Holz und Reisig um den Greis. Als man ihn festnageln wollte, lehnte Polykarp ab:
„Der mich ins Feuer stellt, wird mir auch Kraft geben, ohne Nägel stillzustehen.“ – Polykarp von Smyrna
Was dann geschah, bewegte viele Augenzeugen: Das Feuer verbrannte ihn nicht. Es heißt, es sei wie ein Gewölbe um ihn herum aufgestiegen. Die Umstehenden rochen Wohlgeruch wie von Weihrauch und Myrrhe. Erst ein Dolchstoß beendete sein Leben.
Eine Kirche, die nicht totzukriegen ist
Warum wuchs diese Kirche trotz dieser Verfolgung eigentlich immer noch? Warum lassen sich Menschen auf der ganzen Welt heute noch taufen, leben ihren Glauben mit Hingabe – obwohl Christsein so oft bedeutet hat (und teilweise noch bedeutet), zu leiden?
Christen wurden verbrannt, enthauptet, gekreuzigt, wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Tausende – nein, Hunderttausende – sind gestorben. Und doch blieb diese Kirche nicht stehen. Sie wuchs weiter. Warum nur? Was gab diesen Menschen diese unfassbare Standhaftigkeit? Das ist doch… verrückt.
Um das Jahr 200 schrieb der Kirchenvater Tertullian einen Satz, der durch die Jahrhunderte hallt:
„Wir werden zahlreicher, sooft wir von euch dahingemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche.“ – Tertullian (2./3. Jh.)
Was für eine kraftvolle Aussage! Vielleicht wuchs die Kirche gerade deshalb, weil sie die einzige Bewegung war, deren Mitglieder bereit waren, für ihre Überzeugung zu sterben.
Weil sie nicht zurückschreckten. Weil sie wussten: Diese Geschichte mit Jesus ist wahr. Denn Hand aufs Herz: Wer geht freiwillig in den Tod für etwas, woran er nicht von ganzem Herzen glaubt? Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre – woher hätten diese Menschen die Kraft genommen, ihm selbst im Angesicht des Feuers, des Schwertes und der Löwen treu zu bleiben?
Anwendung: Mut zum Bekenntnis
Es ist traurig – und gleichzeitig wunderschön, was diese Menschen erlebt und durchlitten haben. Sie zeigen: Jesus hat sie nicht allein gelassen. Er hat ihnen die Kraft gegeben, die sie gebraucht haben. Und das erinnert an ein göttliches Prinzip, das schon Josef in Ägypten erlebte:
„Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun; aber Gott gedachte es gut zu machen, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten.“ – 1. Mose 50,20
Auch Paulus bringt es in Worte:
„Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?“ – Römer 8,31–32
Fragen zum weiterdenken:
- Sind Sie dankbar für Ihre Kirche?
- Sind Sie dankbar dafür, dass andere für Ihren Glauben gestorben sind?
- Leben Sie Ihr Leben so, dass es Christus reflektiert und sein Licht in die Welt trägt?
Dann seien Sie einen Teil davon – nicht nur mit Ihrem Namen, sondern mit Ihrem ganzen Leben. Denn es gibt keine bessere Gemeinschaft auf dieser Welt, die so viel durchgemacht hat – und trotzdem lebendiger ist denn je. Und Sie und ich dürfen uns zu dieser Kirche zählen, was ein Privileg!
Ausblick Teil 2:
Dieses hier beschriebene Wunder hat für mich auch eine Kehrseite: Wie gelang es der Kirche, trotz Verstaatlichung und fast schon Verpflichtung, sich nicht mit der Welt zu vermischen? Ist ihr das überhaupt gelungen? Müssten wir nicht vielmehr von den Fehlern lernen? Wie kann die Kirche in der Welt sein, ohne das die Welt in die Kirche dringt? Lesen sie nächste Woche im zweiten Teil, wie der Kirche das damals gelungen ist und auch heute noch gelingen kann.
Literaturverzeichnis
Alle Quellen, die ich für diesen Artikel verwendet habe, finden Sie im deutschen Logos-Store:
- Buchberger, M. (2001). In B. Steimer (Hrsg.), Lexikon der Kirchengeschichte (Bde. 1 & 2). Herder.
- Eusebius von Caesarea. (2022). Kirchengeschichte (Historia Ecclesiastica). Faithlife.
- Kinzig, W. (2019). Christenverfolgung in der Antike. C.H.Beck.
- Parks, J. (2022). Themen der Kirchengeschichte (Zachariah Carter, Hrsg.). Faithlife.
- Sierszyn, A. (2024). 2000 Jahre Kirchengeschichte (Überarbeitete Neuauflage 2024, 7. Gesamtauflage). SCM R.Brockhaus.
- Thompson, J. (2023). Listen zur Kirchengeschichte. Faithlife.




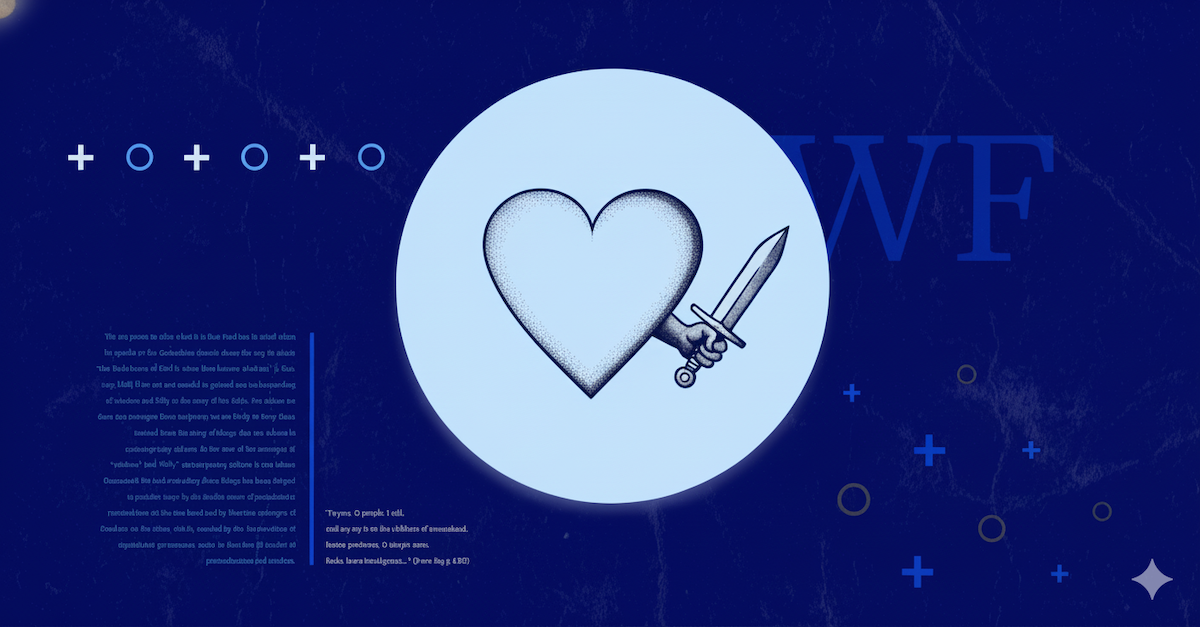
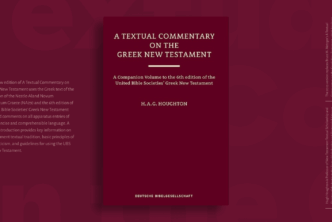
Vieln Dank für ihren wertvollen Blogeintrag. Sie haben es geschafft in wenigen Zeilen einen Überblick der Kirchengeschichte zu geben, der zum Nachstöbern einlädt.
Einen Minuspunkt hätte ich dann doch, bitte verwenden sie die deutsche Sprache so wie diese gedacht ist, ohne Sonderzeichen im Wort und ohne neutrale Neuschöpfungen. Das maskulinum neutrum gibt es, damit keiner vergessen wird. Man muß es nur richtig anwenden.
Ich freue mich auf ihren nächsten Beitrag.
LG
Volkmar
Hallo Volkmar
Vielen Dank für den Hinweis.
Es freut uns, wenn der Blog geschätzt wird.
Liebe Grüsse
Joshua
[…] Teil 1 dieser kleinen Artikelreihe ging es um den Ursprung und die göttliche Gründung der Kirche. Besonders die ersten […]