Wer über 80 Bücher verfasst, einen Lehrstuhl innehat und auch noch Bischof der englisch-anglikanischen Kirche ist, hat vermutlich keine Lust und Zeit, für die normalen Christen Bücher zu schreiben. Doch genau dies tut Nicolas Thomas Wright (N.T. Wright) mit seiner neueren Kommentarreihe zum Neuen Testament. Als leidenschaftlicher Exeget möchte Wright, dass die Bibel nicht nur im akademischen Umfeld, sondern auch in der Gemeinde verstanden wird. Darum kommt sie nun: eine Rezension zu seiner Das Neue Testament für heute Kommentarreihe am Beispiel der Apostelgeschichte.
Inhalt
Wer ist N.T. Wright?
Die Reihe
Die Kommentarreihe Das Neue Testament für heute von N.T. Wright erschließt das gesamte Neue Testament in 18 Bänden. Ursprünglich zwischen 2004 und 2013 unter dem englischen Titel New Testament for Everyone: Commentaries bei SPCK (Society for Promoting Christian Knowledge) und Westminster John Knox erschienen, präsentiert sie sich in der deutschen Übersetzung des Brunnen Verlags als inspirierender Begleiter für Bibelleser. Obwohl die Reihe nicht brandneu ist, bietet sie einen frischen Blick auf die biblischen Texte und deren Bedeutung für heute.
Wright hat die Kommentare in Form allgemeinverständlicher Taschenbücher verfasst, die bewusst keine technischen Bibelkommentare sind. Stattdessen handelt es sich um erzählerische Einführungen, die den Leser schrittweise in die Welt des Neuen Testaments hineinführen. Seine Texte bieten konzentrierte Hinweise auf die geschichtlichen Hintergründe, prägnante Interpretationen und praxisnahe Gedanken zur Relevanz der biblischen Botschaft im Alltag.
Wrights eigene Bibelübersetzung
Bemerkenswert ist, dass Wright in der englischen Originalfassung nicht nur die Kommentare schrieb, sondern auch eine eigene Übersetzung des Neuen Testaments vorlegte, um den Text in frischer Weise zum Klingen zu bringen. In der deutschen Ausgabe wurde versucht, die Feinheiten und Eigenheiten seiner englischen Übersetzung durch eine präzise sprachliche Übertragung einzufangen. In diesem Sinne ist Wrights Übersetzung des Neuen Testaments auch in der deutschen Ausgabe präsent, wenn man die gesamte Reihe liest – seine Gedankenwelt und seine sprachliche Finesse sind darin auf eindrucksvolle Weise spürbar.
Der Ansatz Wrights hebt hervor, wie der biblische Text in seinem historischen Kontext verstanden werden kann, und lädt dazu ein, neue Zusammenhänge und Perspektiven zu entdecken. Seine narrative Art lässt die biblischen Geschichten lebendig werden, sodass Leser nicht nur die Hintergründe und Strukturen besser verstehen, sondern vor allem, wie diese Texte heute noch sprechen und wirken können.
Deutsche Übertragung
Die deutsche Übersetzung durch den Brunnen Verlag macht diese zugängliche und bereichernde Reihe für ein breites Publikum verfügbar und bietet damit eine einzigartige Möglichkeit, das Neue Testament auf eine persönliche und theologisch fundierte Weise zu erkunden. Der Brunnen Verlag schreibt auf ihrer Homepage dazu:
„Wright erzählt die biblischen Texte neu. Er öffnet dem Leser nicht nur die Augen für viele bisher unentdeckte Hintergründe und Zusammenhänge, sondern vor allem dafür, wie er heute Jesus nachfolgen kann. Mit eigener, oftmals überraschender Bibelübersetzung. Jeder Abschnitt stellt zuerst mit einer Anekdote oder einem aktuellen Bezug die Verbindung zu uns heute her. Die leicht zugängliche, einfache Auslegung lässt den Text vor dem Hintergrund der Welt der Bibel lebendig werden.”
Wrights Kommentar zur Apostelgeschichte
Und so wird hier schließlich der 2‑bändige Kommentar zur Apostelgeschichte etwas genauer unter die Lupe genommen.
Übersicht und Einleitung
N.T. Wrights Einleitung zur Apostelgeschichte setzt einen inspirierenden Ton und vermittelt das Herzstück seines Kommentars: Die Botschaft von Jesus Christus ist universell, relevant und lebendig – damals wie heute. Wright beschreibt die Ereignisse von Pfingsten als Wendepunkt, an dem der Geist Gottes die ersten Nachfolger Jesu mit neuer Kraft erfüllte und eine Botschaft verkündet wurde, die Menschen aller Generationen und Orte betrifft. Der Beginn der Kirche, geprägt von Petrus’ mutiger Predigt, markierte den Start eines neuen Zeitalters, in dem Vergebung, Hoffnung und Gottes Wirken jedem Menschen zugänglich gemacht wurden.
Die Apostelgeschichte steht für Wright als Symbol der Energie und Dynamik der frühen Christen. Sie erzählt von Gottes Wirken, Herausforderungen in der Gemeinde und mutigen Missionsreisen, die oft mit Konflikten und Krisen verbunden waren. Wright zeigt, wie aktuell die Themen der Apostelgeschichte bleiben: Leiterschaft, Geld, kulturelle Spannungen, Theologie und Ethik – diese Herausforderungen sind bis heute relevant. Dabei ermutigt Wright die Leser, die Parallelen zwischen den Reisen der Apostel und den „Reisen“ im eigenen Glaubensleben zu erkennen. Die Botschaft ist klar: Der Geist Gottes, der die frühe Kirche bewegte, wirkt auch heute und befähigt uns zu einem fruchtbaren Dienst.
Petrus und Johannes vor dem Tempel
In Apostelgeschichte 3,1–10 wird die Heilung eines von Geburt an gelähmten Mannes beschrieben, der täglich vor der „Schönen Pforte“ des Tempels sitzt, um Almosen zu erbetteln. Als Petrus und Johannes vorbeikommen, bittet der Mann sie um Geld. Petrus antwortet, dass er kein Geld hat, aber im Namen Jesu von Nazareth befiehlt er dem Mann, aufzustehen und zu gehen. Wright schreibt dazu:
„Petrus’ Antwort ist besonders spannend, wenn wir an das denken, was wir am Ende des vorherigen Kapitels über die Gläubigen hörten, die ihren Besitz teilten. Geld hatte aufgehört, die wichtigste Sache für sie zu sein. Es gab eine neue Kraft, eine neue Art des Lebens, die sie entdeckt hatten. Also war das, was Petrus sagte, die natürliche Antwort. Er hatte kein Geld, aber er hatte etwas viel Besseres, etwas aus einer ganz anderen Kategorie. Er fragte den lahmen Mann nicht einmal, ob er geheilt werden möchte. Er schritt einfach zur Tat und heilte ihn im Namen Jesu” (Seite 74).
Sofort wird der Mann geheilt, steht auf und folgt den Aposteln in den Tempel, wo er Gott lobt. Die Menschen, die ihn zuvor als Bettler kannten, sind erstaunt über das Wunder. Der Text hebt hervor, dass Petrus und Johannes den Mann intensiv ansahen, was auf einen tiefen menschlichen Kontakt und die Bereitschaft hinweist, ihm mehr zu geben, als er erbeten hatte. Die Heilung geschieht durch die Kraft des Namens Jesu, was in der damaligen Zeit eine bedeutende Vorstellung war. Der Name Jesu hat die Macht, neue Möglichkeiten zu schaffen und Wunder zu bewirken. Heute versteht man die Macht von Namen kaum noch. Wright hilft dem Leser deshalb auf die Sprünge:
„Es ist die Kraft des Namens von Jesus, die zählt, hier und überall. Der Gedanke, dass Namen Kraft haben, ist uns in der modernen westlichen Welt fremd (obwohl wir manchmal ganz schwach etwas davon ahnen, wenn eine wichtige Person, eine Führungskraft in einer Behörde oder einem Unternehmen oder vielleicht ein ranghoher Politiker, sagt: „Erwähnen Sie einfach nur meinen Namen und sie werden Sie reinlassen“). Aber die meisten Menschen in der Welt des ersten Jahrhunderts und heutzutage viele Menschen in nichtwestlichen Ländern wissen genau, was hier los ist. Natürlich haben Namen Macht!” (Seite 75).
Diese Perikope zeigt, dass die Botschaft von Jesus nicht nur im Tempel, sondern auch außerhalb der religiösen Institutionen wirkt. Die Heilung des Mannes ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Macht und die gute Nachricht von Jesus alle Menschen erreichen sollen, unabhängig von ihrem sozialen Status oder ihrer Situation. Dies markiert den Beginn einer breiteren Verbreitung des Glaubens über Jerusalem hinaus.
Paulus auf dem Areopag
In Apostelgeschichte 17,22–34 spricht Paulus auf dem Areopag zu den Athenern und thematisiert den „unbekannten Gott“, den sie verehren. Er erklärt, dass dieser Gott der Schöpfer der Welt ist, der nicht in Tempeln wohnt und nicht auf menschliche Versorgung angewiesen ist. Paulus betont, dass Gott nahe bei den Menschen ist und sie dazu einlädt, eine Beziehung zu ihm zu suchen. Er fordert die Menschen auf, von ihrer Unwissenheit umzukehren, da die Zeit der Unwissenheit vorbei ist. Gott hat einen Tag festgelegt, an dem er die Welt richten wird, und dies geschieht durch einen bestimmten Mann, den er auferweckt hat.
Paulus konfrontiert die philosophischen und heidnischen Ansichten mit intellektuellen Gedanken. Wright schreibt dazu:
„Nun werden wir sehen, wie er sich sowohl mit den Epikureern als auch den Stoikern auseinandersetzt und dabei zeigt, wie dieser Gott nicht nur erkannt werden kann, und zwar auf eine Weise, die die griechische Philosophie niemals in Betracht gezogen hatte, sondern dass er tatsächlich erkannt werden will. Und er bringt die Ansprache mit einem Fanfarenstoß zu Ende, indem er die (wiederum sehr jüdische) Story von der zukünftigen Hoffnung erzählt: Gott wird eine große Gerichtssitzung halten und die ganze Welt ins Lot bringen!
Für den Epikureer waren die Götter weit weg und wollten nichts mit uns zu tun haben. Für Paulus ist Gott sehr nahe bei uns, er gibt uns alles, er sucht uns leidenschaftlich, er möchte, dass wir ihn im Gegenzug suchen – und daher will er keine Tieropfer von uns. Paulus stimmt dem Epikureer zu, dass Gott und die Welt nicht dasselbe sind. Aber er konfrontiert den Epikureer ganz direkt, wenn er sagt, dass Gott nicht weit von jedem von uns ist und dass er sich nach einer Beziehung der Liebe zu allen seinen menschlichen Kreaturen sehnt. Der Epikureer würde fasziniert sein, verwundert, vielleicht irritiert, aber genug angestachelt, um mehr hören zu wollen.
Im Gegensatz dazu hätte der Stoiker erfreut gehört, dass es tatsächlich ein göttliches Leben gibt, das in allen menschlichen Wesen ist (Pantheismus). Paulus erklärt dem stoischen Pantheisten, dass Gott und die Welt nicht dasselbe sind, aber dass der Impuls, der jemanden zu der Annahme drängt, sie wären dasselbe, der wahre Impuls ist, der einen Menschen dazu führen sollte, sich nach dem echten Gott auszustrecken und den zu ergreifen, der tatsächlich nicht weit weg ist. Der Stoiker wird daher wie der Epikureer herausgefordert, ermutigt, angestachelt und vielleicht angelockt, diese Sache näher in Betracht zu ziehen (Seite 127–129).”
Am Ende seiner Rede spricht Paulus die Auferstehung Jesu an, die als Beweis für Gottes Handeln in der Welt dient. Diese Auferstehung ist der Wendepunkt, der die Menschen dazu aufruft, umzukehren und den lebendigen Gott zu suchen. Einige Zuhörer zeigen Interesse und schließen sich Paulus an, was die Möglichkeit einer Transformation in ihrem Glauben andeutet.
Fazit zum Kommentar
Fazit zur Reihe
Besonders hebt Wright die Breite und Zielrichtung der biblischen Schriften hervor: Sie waren nie exklusiv für eine religiöse Élite gedacht, sondern sollten alle Menschen ansprechen. Genau diesem Ziel widmet sich Wrights Kommentarreihe. Mit einer klaren Sprache, die komplizierte theologische Begriffe erklärt, richtet er sich insbesondere an Leser, die nicht mit wissenschaftlichem Jargon vertraut sind. Hilfreiche Glossare am Ende der Bände machen diese Werke besonders zugänglich.
Die Reihe Das Neue Testament für heute ist demnach ein herausragendes Projekt von N.T. Wright, das sich durch eine einfache, aber fundierte Darstellung der neutestamentlichen Bücher auszeichnet. Wright gelingt es, eine Brücke zwischen akademischer Forschung und einer breiteren Leserschaft zu schlagen, indem er den Text in einen greifbaren historischen, kulturellen und theologischen Kontext einbettet. Besonders für Leser, die mit dem Fachjargon theologischer Wissenschaften weniger vertraut sind, ist diese Reihe ein Gewinn. Wrights eigene Übersetzung des Neuen Testaments, die in der Reihe integriert ist, verleiht dem Werk einen einzigartigen Charakter und transportiert seine frischen, oft überraschenden Perspektiven direkt in die Interpretation des Textes.
Theologische Spannungen
Es sei jedoch erwähnt, dass Wright als Verfechter und Mitbegründer der Neuen Paulus-Perspektive (New Perspective on Paul) teils kontroverse Positionen vertritt. Diese Perspektive hinterfragt traditionelle reformatorische Ansätze zur Rechtfertigungslehre und betont stärker den jüdischen Kontext von Paulus’ Denken. Insbesondere Wrights Ablehnung des Konzepts der doppelten Imputation und seine Betonung der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Gläubigen als Kern der paulinischen Theologie stoßen bei Anhängern der klassischen reformatorischen Sichtweise auf Kritik. Für Leser, die sich dieser Perspektive nicht anschließen, mag dies Spannungen erzeugen. Dennoch bietet die Reihe eine wertvolle Gelegenheit, sich auf eine andere Sichtweise einzulassen und den Horizont zu erweitern. Wrights Werk ermutigt dazu, den biblischen Text aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und die tiefe Bedeutung des Evangeliums für jeden Einzelnen zu entdecken. Um Ihnen einen leichteren (leider oft englischen) Zugang zu seiner LIteratur zu ermöglichen, habe ich zum Abschluss eine Übersicht über seine wichtigsten Werke erstellt.
Übersicht über Publikationen von N. T. Wright
Das Neue Testament für heute
Die Bände dieser Reihe sind auch einzeln erhältlich.
God and the Pandemic (Hörbuch; englisch)
Surprised by hope
Paul and his recent interpreters
Christian Origins and the Question of God Series (4 Bände)



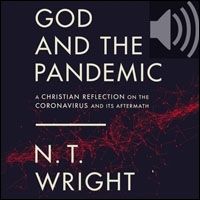
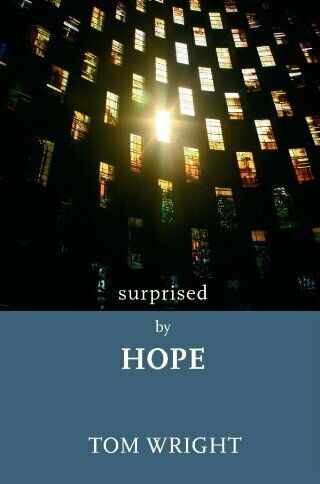
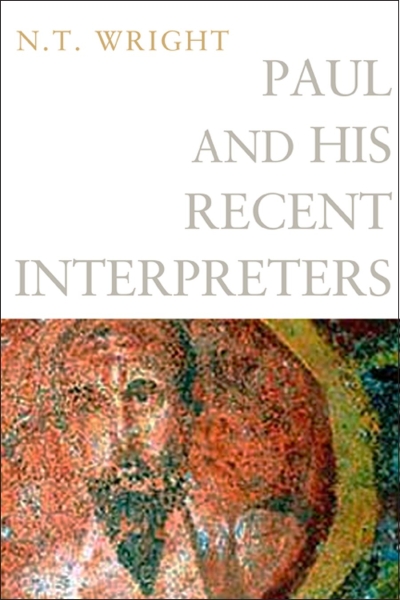



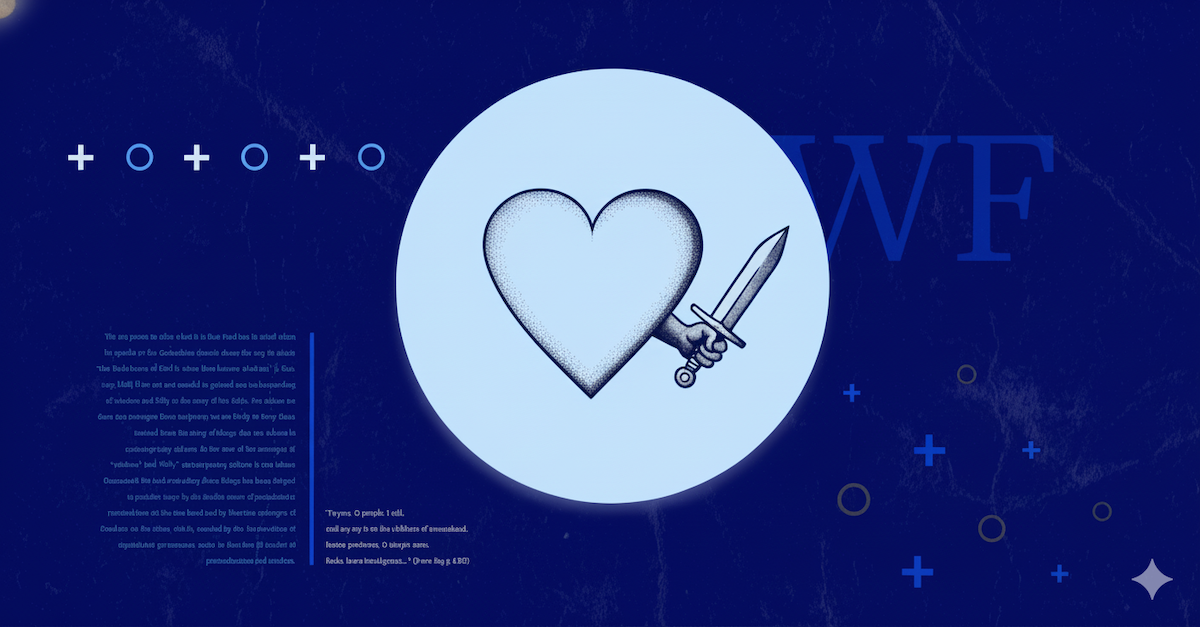
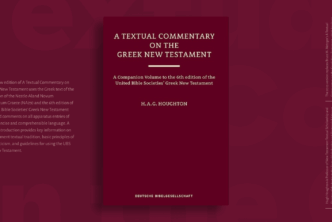
Danke, dass dieser Beitrag die theologische Besonderheit (meiner Meinung nach Irrlehre) des Autors erwähnt, nämlich die Neuen Paulus-Perspektive (New Perspective on Paul). Andere Beiträge auf diesem Blog sind oft zu unkritisch und einseitig. Ich jedenfalls habe alle Autoren der NPP aus meiner Logos-Bibliothek verbannt, auch N.T. Wright.
Guten Tag Rafi
Danke für deinen Beitrag. Grundsätzlich haben wir bei Logos eine Programmphilosophie. Diese erklärt in Grundzügen, warum wir eine theologische Breite haben und auch solche Werke wie die von N.T. Wright verkaufen. Du findest diese Grundsätze unter https://de.logos.com/programmphilosophie. Zudem ist das Unternehmen Logos/Faithlife als christlicher Verlag einer Vereinigung (The Evangelical Christian Publishers Association (ECPA)) angeschlossen, welche auch ein Statement of faith berücksichtigt. Dieses findest du hier: https://www.ecpa.org/page/about_ecpa.
Wir möchten auf diesem Blog bewusst eine gewisse breite haben. Zudem möchten wir in Demut und Nächstenliebe andere Ansichten stehen lassen. Auch wenn N.T. Wright mit der NPP provoziert, halten wir uns zurück, sie zu kritisieren oder gar als Irrlehre abzustempeln. Wir dürfen sie natürlich bewerten und kritisch würdigen, absolut.
Sicherlich kennst du das Zitat des Kirchenvaters Augustinus: „Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe.”
Nun lässt sich darüber streiten, was das „wesentliche” des Evangeliums ist und wie diese Einheit aussehen soll, dass ist völlig klar.
Logos hängt sich keiner Denomination oder Konfession an, was natürlich automatisch dazuführt, dass gewisse Werke für den einen oder anderen Logos-Nutzer irritieren können. Ich empfehle dir herzlich, die Programmphilosophie durchzulesen und dich noch einmal für Fragen zu melden.
Freundliche Grüsse
Joshua