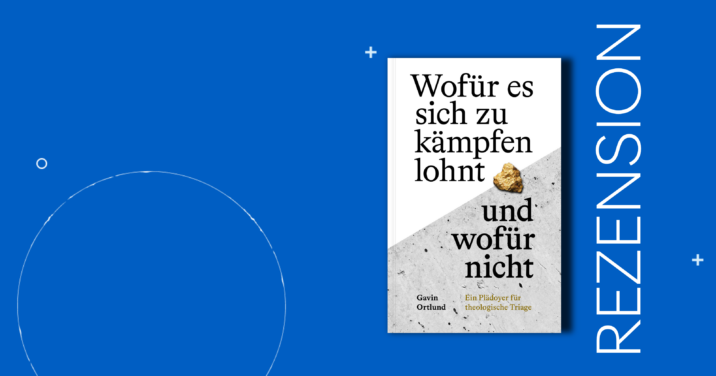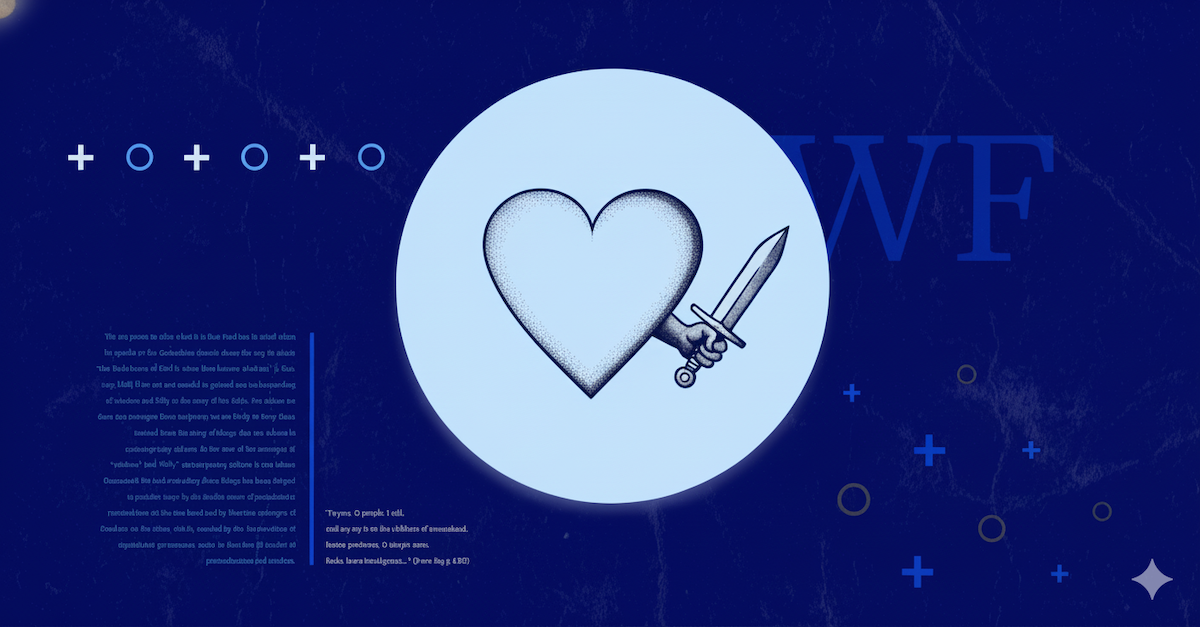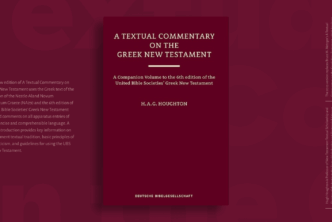„In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.“
– Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allem Liebe.
Diese Aussage scheint auf den ersten Blick Frieden in theologische Diskussionen und unterschiedlichen Lehren zu bringen. Und das Zitat ist auch wichtig und richtig. Doch Autor und Theologe Gavin Ortlund sieht darin auch Gefahren: Unterschiedliche Haltungen und Positionen könnten auf der einen Seite in eine Gleichgültigkeit umkippen. Denn wenn alles gleich gültig wird, wird letztlich alles gleichgültig. Das klingt bereits nach einer Relativität, wie sie im postmodernen Alltag geworden ist. Andererseits erleben wir auch, wie oft Gemeinden wegen Fragen zerrüttet oder gar gespaltet werden, die es eigentlich nicht wert sind.
Zwischen diesen beiden Extremen – theologischem Maximalismus und gefährlichem Minimalismus – sucht Gavin Ortlund in seinem Buch Wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht: Ein Plädoyer für theologische Triage nach einem Weg der Weisheit. Und genau dieses Buch möchte ich Ihnen in den nächsten 10 Minuten näherbringen.
Inhalt
Verlag und Autor
Gavin Ortlund ist ein US-amerikanischer evangelikaler Theologe, Pastor, Autor und Apologet. Er leitet die First Baptist Church of Ojai (Kalifornien, USA) als Senior Pastor. Gavin Ortlunds Buch kam 2020 bei Crossway, Illinois unter dem englischen Originaltitel The right hills to die on: The case for theological triage (Die richtigen Hügel, um im Kampf zu sterben: ein Argument für theologische Triage) heraus. Die deutsche Übersetzung erfolgte 2025 vom Verbum Medien Verlag in Bad Oeynhausen. Beide Ausgaben sind im Logos-Store ab sofort verfügbar.
In diesem Buch plädiert Ortlund, dass wir intuitiv und oft unbewusst verschiedene Lehren der Bibel einerseits unterschiedlich stark gewichten und andererseits auch priorisieren.
„Es gibt keine Lehre, für die ein Liberaler kämpfen würde und keine Lehre, für die ein Fundamentalist nicht kämpfen würde“ – Seite 13.
Diese beiden von Ortlund angesprochenen Tendenzen bergen großes Potenzial, Dinge kaputt zu minimalisieren oder zu vergrößern. In diesem Buch geht es darum, die goldene Mitte zwischen diesen Extremen zu finden. Wofür lohnt es sich, eine Diskussion zu starten, jemandem zu widersprechen, und wo lohnt es sich nicht? Mit welchen Gruppierungen und Menschen muss man eine größere Übereinstimmung mit theologischen Positionen vertreten, und wo ist der kleinste gemeinsame Nenner auch ausreichend?
Übersicht über das Buch
In der Einleitung führt Ortlund ins Thema ein und nutzt es, um in den ersten beiden Kapiteln zwei gegensätzliche Gefahren aufzuzeigen, die wichtig zu kennen sind.
Im ersten Kapitel zeigt er die Gefahr einer theologischen Zersplitterung auf (Wo spalten sich Christen oder Gemeinden „unnötig?“). Im zweiten Kapitel geht es genau ums Gegenteil; die Gefahr des theologischen Minimalismus (gleichgültig gegenüber Unterschieden in wichtigen Lehrfragen). Dabei führt er jeweils Begründungen auf, warum die Bibel selbst klare Unterscheidungen in der Wichtigkeit macht. Ein Beispiel: Für Paulus ist die Auferstehung das Wichtigste, ob Leute Single bleiben oder heiraten, überlässt er jedem persönlich und gibt nur einen Ratschlag ab.
Im dritten Kapitel wird Ortlund sehr praktisch. Er bleibt nicht theoretisch. Er gewährt Einblick in seinen eigenen Weg und erzählt, wie sich seine Überzeugungen im Laufe der Jahre verändert haben – etwa in Bezug auf das Millennium oder die Tauffrage. Diese Offenheit macht das Buch besonders authentisch. Zugleich bleibt es praxisnah. Er gibt konkrete Hilfestellungen zur Einordnung (S. 89–95) und bringt anschauliche Fallbeispiele. So kann man die Kategorien sofort auf eigene Fragen übertragen. Das Buch hilft also nicht nur beim Denken, sondern auch beim Reden – in Gemeinde, Hauskreis und persönlichen Gesprächen.
Die Kapitel 4–6 untersuchen verschieden wichtige Lehren unter dem Gesichtspunkt der Triage. Darin werden von Ortlund Kriterien ermittelt, anhand derer man die Gewichtigkeit unterschiedlicher Themen einstufen kann.
Im vierten Kapitel legt Ortlund dar, dass erstrangige Lehren Mut und Überzeugung erfordern, sofern man sie auch als den Kern des Evangeliums glaubt und lebt. Im fünften Kapitel werden zweitrangige Lehren diskutiert. Die dortige Haltung sei Weisheit und Ausgewogenheit. Für drittrangige und weniger wichtige /klare Lehren brauche es Umsicht und Zurückhaltung, so Ortlund.
Theologische Triage: Was ist das?
Der Begriff „Triage“ stammt aus der Notfallmedizin: Wo viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen, braucht es eine sinnvolle Priorisierung. Die Grundidee ist: Nicht jeder Patient kann sofort behandelt werden – daher wird entschieden, wer zuerst medizinisch versorgt werden muss, wer warten kann und wer keine Aussicht auf Rettung mehr hat. Die Einschätzung erfolgt meist durch erfahrene Notärzte oder medizinisches Fachpersonal, oft innerhalb weniger Sekunden bis Minuten. Dabei werden zwischen den verschiedenen Priorisierungsstufen unterschieden:
- Sofortbehandlung erforderlich:
Schwer verletzte oder kritisch erkrankte Patienten, die ohne sofortige Hilfe sterben würden, aber mit Behandlung eine Überlebenschance haben. - Dringend, aber nicht kritisch:
Patienten mit schweren, aber stabilen Verletzungen oder Erkrankungen. Behandlung kann kurzzeitig aufgeschoben werden. - Leicht verletzt oder stabil:
Patienten mit nur geringen Verletzungen oder Symptomen, die warten können oder sich selbst helfen können.
Ortlund überträgt dieses Prinzip auf theologische Fragen. Nicht jede Lehre ist gleich wichtig und gewichtig. Und nicht jede Meinungsverschiedenheit muss zur Trennung führen. Um Triage auf die Theologie überhaupt anwenden zu können, macht Ortlund zwei Punkte deutlich:
- Unterschiedliche Lehren haben unterschiedlich große Bedeutung. Die eine Lehre ist mit dem innersten, wichtigsten verwoben, eine andere Lehre ist zweitrangig und weniger klar.
- Es gibt eine gewisse Dringlichkeit. Je dringender ein Thema ist, desto wichtiger ist eine gemeinsame Sicht der Dinge.
Seine Kategorisierung
Dieses Prinzip erfindet Ortlund nicht neu. Er macht darauf aufmerksam, dass es bereits hilfreiche Konzepte und Abstufungen gibt (S. 191–192). Und doch möchte er eine eigene Unterscheidung vorschlagen:
- Evangeliums-essentielle Lehren: Wer diese ablehnt, untergräbt das Evangelium. Beispiele: Dreieinigkeit, Jungfrauengeburt, Rechtfertigung aus Glauben.
- Gemeindepraktisch notwendige Lehren: Unterschiede hier machen gemeinsames Gemeindeleben schwierig und führen zu notwendigen Spaltungen (z. B. Taufpraxis, Frauen in Leitungsrollen, Geistesgaben).
- Wichtige, aber nicht trennende Lehren: Fragen, die zwar bedeutend sind, aber keine Spaltung rechtfertigen (z. B. Endzeitmodelle, Schöpfungsalter).
- Theologisch unwichtige Fragen: Themen, die keine praktische oder lehrmäßige Relevanz für Evangelium oder Gemeinde haben (S. 16).
Erste Gefahr:Die theologische Zersplitterung
Das erste Kapitel handelt von der Gefahr der theologischen Zersplitterung innerhalb der Kirche und betont die Notwendigkeit, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Glaubensüberzeugungen zu unterscheiden. Theologische Zersplitterung führt zu unnötigen Spaltungen im Leib Christi, was die Einheit der Gemeinde gefährdet. Ortlund verweist auf berühmte Theologen der Kirchengeschichte wie Francis Turretin und Johannes Calvin, die die Bedeutung der Unterscheidung zwischen primären und sekundären Lehren betonten, um die Einheit der Kirche zu bewahren. Sie warnten davor, unwesentliche Lehren zu erheben und damit die Gemeinschaft unter Christen zu gefährden. (28–33)
Ortlund argumentiert, dass die Einheit der Gemeinde für ihren Auftrag und ihre Identität entscheidend ist. Jesus selbst betete für die Einheit seiner Nachfolger, um die Welt zu zeigen, dass er vom Vater gesandt wurde. Die Einheit ist nicht nur eine innere Angelegenheit, sondern hat auch Auswirkungen auf die Evangelisation. Ortlund hebt hervor, dass theologischer Eifer immer von Liebe begleitet sein sollte, um die Heiligkeit der Gemeinde zu fördern und nicht zu schädigen.
Zusammenfassend wird betont, dass die Identität der Christen im Evangelium und nicht in theologischen Differenzen gefunden werden sollte. Ein Geist der Selbstgerechtigkeit kann zu Spaltungen führen, während die Rückkehr zu Christus und die Wertschätzung der Einheit unter den Gläubigen entscheidend sind, um die Mission der Kirche zu erfüllen.
Zweite Gefahr: Theologischer Minimalismus
Das zweite Kapitel behandelt die Gefahren des theologischen Minimalismus und die Bedeutung theologischer Lehren, auch wenn sie als unwesentlich eingestuft werden. Theologischer Minimalismus, der oft aus dem Wunsch entsteht, Spaltungen zu vermeiden, führt dazu, dass wichtige Lehrfragen vernachlässigt werden. Ortlund argumentiert, dass eine klare Definition von Jesus und anderen theologischen Konzepten notwendig ist, um dem Glauben treu zu bleiben.
Unwesentliche Lehren sind nicht irrelevant, sondern tragen zur Tiefe des Glaubens bei und beeinflussen, wie das Evangelium verstanden und gelebt wird. Der Autor verweist auf historische Beispiele, in denen Christen für ihre Überzeugungen, auch in Bezug auf unwesentliche Lehren, gelitten haben. Diese Lehren sind oft eng mit den wesentlichen Lehren verbunden und können deren Verständnis und Anwendung beeinflussen. (51–60).
Zudem wird die Notwendigkeit betont, theologische Fragen ernst zu nehmen und nicht gleichgültig zu behandeln. Eine solche Gleichgültigkeit könnte die Integrität des Glaubens gefährden.
Warum sind erstrangige Lehren oft einfacher als zweitrangige themen?
Erstrangige Lehren sind entscheidend für das Evangelium, da sie entweder die Grenze zu rivalisierenden Ideologien markieren oder wesentliche Punkte des Evangeliums darstellen, wie die Jungfrauengeburt und die Rechtfertigung. Der Autor nennt Kriterien zur Einstufung von Lehren, darunter biblische Klarheit, Relevanz für den Charakter Gottes und Auswirkungen auf das Gemeindeleben. Es wird betont, dass die theologische Triage nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch ist und dass der Wunsch nach Wachstum in Heiligkeit und Liebe entscheidend ist.
Der Text diskutiert auch, dass nicht alle erstrangigen Lehren heilsentscheidend sind, da Menschen unter bestimmten Umständen mit begrenztem Wissen gerettet werden können. Es wird zwischen dem, was bejaht werden muss, und dem, was nicht verneint werden darf, unterschieden. Die Jungfrauengeburt wird als Beispiel für eine erstrangige Lehre angeführt, die für die Verteidigung des Evangeliums wichtig ist. Ebenso wird die Rechtfertigung durch Glauben als zentraler Bestandteil des Evangeliums hervorgehoben, wobei die Apostel im Neuen Testament oft für diese Lehre kämpfen. Insgesamt wird die Notwendigkeit betont, für erstrangige Lehren einzutreten, um das Evangelium zu schützen und zu verkünden, da ihre Ablehnung das Evangelium gefährden kann.
Zweitrangige Lehren: sehr zentral, und doch nicht klar genug
Zweitrangige Lehren sind solche, die das Verständnis und die Ausdrucksweise des Evangeliums beeinflussen, ohne es grundlegend zu verändern. Sie sind nicht essenziell für das Evangelium, können jedoch zu Spaltungen innerhalb der christlichen Gemeinschaft führen. In diesem Kontext werden drei umstrittene Themen behandelt: die Taufe, die Geistesgaben und die Rolle von Frauen in der Gemeinde.
Die Taufe ist ein Beispiel für eine Lehre, die sowohl Gehorsam gegenüber Christus als auch die Identität innerhalb der Gemeinde betrifft. Es gibt unterschiedliche Ansichten zur Glaubenstaufe und Kindertaufe, die historisch zu heftigen Konflikten führten. Die Geistesgaben, insbesondere Cessationismus und Kontinuationismus, zeigen ebenfalls, wie unterschiedliche Überzeugungen zu praktischen Unterschieden in der Gemeindearbeit führen können.
Die Debatte über die Rolle von Männern und Frauen in der Gemeinde, zwischen Komplementarismus und Egalitarismus, ist ein weiteres Beispiel für ein zweitrangiges Thema, das jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Gemeindeleitung und die Ehe hat.
Die Komplexität dieser Themen erfordert Weisheit und eine ausgewogene Haltung. Es ist wichtig, die Unterschiede zu respektieren und die Einheit im Glauben zu wahren, während man die eigenen Überzeugungen vertritt. Letztlich sollten Christen in der Diskussion über zweitrangige Lehren Demut, Klarheit und Kooperationsbereitschaft zeigen, um die Gemeinschaft im Glauben zu fördern und das Evangelium glaubwürdig zu bezeugen.
Für wen ist das Buch geeignet?
Wofür es sich zu kämpfen lohnt – und wofür nicht ist kein akademisches Fachbuch, aber auch kein oberflächlicher Ratgeber. Es ist geschrieben für Christen, die theologisch denken und leben wollen:
- - Für Pastoren und Älteste, die in Streitfragen Orientierung bieten müssen
- - Für Theologiestudierende, die lernen wollen, Prioritäten zu setzen
- - Für engagierte Laien, die in einem geeigneten Rahmen diskutieren möchten
- - Für Gemeindeleitungen, die Einheit fördern und trotzdem Klarheit bewahren sollen
Fazit: Klarheit und Liebe in der Spannung halten
Ortlund liefert zwar keine revolutionär neuen Gedanken, aber ein klares, brauchbares Raster. Zudem startet er mit diesem jetzt auch auf Deutsch verfügbaren Buch eine sehr wichtige Diskussion um die Dringlichkeit, Priorisierung und den Umgang mit abweichenden Lehrmeinungen.
Gavin Ortlund liefert mit Wofür es sich zu kämpfen lohnt – und wofür nicht ein gut lesbares, ausgewogenes und pastoral hilfreiches Buch zur theologischen Urteilsbildung. Die Stärke des Buches liegt in seinem versöhnlichen Grundton, seiner geistlichen Tiefe und der Fähigkeit, Komplexität verständlich zu machen. Besonders wertvoll ist sein Aufruf zur Demut, zur Differenzierung und zur Liebe innerhalb theologischer Gespräche.
Allerdings sehe ich einen Schwachpunkt in seiner Vier-Kategorien-Einteilung. Zwar ist die Unterscheidung grundsätzlich hilfreich, doch die zweite Kategorie – „für die Gesundheit der Gemeinde dringliche Lehren“ (s. 16) – bleibt in der Praxis oft problematisch. Ortlund selbst gesteht ihr ein hohes Spaltungspotenzial zu, da Themen wie Tauffrage oder Frauen im Dienst dort angesiedelt werden. Das hat zur Folge, dass Spaltungen nicht nur erklärt, sondern faktisch auch theologisch legitimiert werden.
Was geschieht, wenn sich etwa Leitungskreise nicht einig sind, ob Frauen predigen dürfen oder nicht? Wird das automatisch zur Trennungsfrage? Auch wenn Ortlund dies nicht pauschal befürwortet, öffnet die zweite Kategorie genau diesen Raum – und wird so zum Einfallstor für neue Lagerbildungen. Daher schlage ich eine alternative, dreifache Kategorisierung vor.
Alternative Kategorien
- Eine erste Kategorie mit zentralen, unverzichtbaren Lehren, die das Evangelium im Kern definieren (etwa: Kreuz, Auferstehung, Dreieinigkeit, Rechtfertigung aus Glauben). Diese sind für die geistliche Einheit grundlegend. Oft entscheidet sich bereits hier, ob man mit anderen Denominationen und Konfessionen Gottesdienste, oder zumindest Gebetsabende gestalten kann. Denn in diesem Punkt sind sich die meisten Christen einig (auch wenn, wie ich es ja selbst tue, sich die Kategorien und Einteilungen zwischen Christen unterscheiden. Für mich wäre nämlich die Frauenfrage in der Kategorie von Ortlund in der dritten Kategorie, er stuft sie als dringlicher und zentraler ein).
- Eine zweite Kategorie mit wichtigen, aber nicht trennenden Themen – z. B. Tauffrage, Gemeindeleitung oder geistliche Gaben. Sie erfordern Differenzierung und Gespräch, sollten aber nicht zur Spaltung führen.
- Eine dritte Kategorie mit Fragen, die keine direkte theologische Relevanz haben, etwa die genaue Anzahl der Engel, liturgische Formen, Bibelübersetzung im Gottesdienst oder verwendete Instrumente.
Abschluss
Diese dreistufige Struktur hilft, einerseits das Evangelium klar zu bewahren und andererseits geistlich und theologisch mit Vielfalt umzugehen. Sie schützt vor unnötigen Spaltungen und leitet zu einem respektvollen, bibelzentrierten Miteinander an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jakobus, Petrus und die restlichen Apostel in Apg 15 einen ähnlichen Weg gegangen sind, um in zentralen Fragen zu einer Einheit zu gelangen.
Ortlund will Brücken bauen – und das gelingt ihm in vielem. Aber an dieser Stelle braucht es noch stärkere theologische Gelassenheit – und vielleicht den Mut, nicht immer den einfacheren Weg der Abgrenzung zu wählen. Denn offene, sichtbare Spannungen aushalten ist oft energieraubender, als sich abzugrenzen.
Mich hat das Buch enorm inspiriert. Es hat zudem mein Denken und meine Offenheit gegenüber andere Denominationen und Konfessionen vergrössert. Schliesslich ist in folgendem Spruch doch sehr viel objektive Wahrheit, aber auch Praxisnähe:
„In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.“
Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allem Liebe.
– auf das 17. Jahrhundert datiert, Autor unbekannt.
Bibliografie:
Gavin Ortlund: Wofür es sich zu kämpfen lohnt – und wofür nicht. Ein Plädoyer für theologische Triage, Verbum Medien 2025, 212 S., 18,90 EUR ( Im Logos-Store natürlich viel günstiger zu haben!)