Wer ist Rudolf Bultmann? Was hat Gotthold Ephraim Lessing mit den synoptischen Evangelien zu tun? Warum wird eine mögliche Abhängigkeit der ersten drei Bücher des Neuen Testaments diskutiert? Wie glaubwürdig und authentisch sind die so genannten synoptischen Evangelien? Und was hat das alles mit meiner täglichen Bibellese zu tun?
Verschaffen Sie sich in 9 Minuten einen komprimierten Überblick über die inhaltliche Übereinstimmung der synoptischen Evangelien und vor allem über ihre Relevanz. Ich möchte Ihnen diesen Überblick anhand eines bekannten Standardwerkes von Eta Linnemann geben.
Inhalt
- Wie viele Evangelien haben wir?
- Eta Linnemann
- Die historisch-kritische Methode
- Besteht eine literarische Abhängigkeit zwischen den drei synoptischen Evangelien?
- Können die drei synoptischen Evangelien unabhängig voneinander entstanden sein?
- Wozu haben wir vier Evangelien, und wie gehen wir damit um?
Wie viele Evangelien haben wir?
Ich glaube nur an das eine Evangelium! Schön! Richtig!!! Aber warum gibt es im Neuen Testament vier Berichte, die sich teilweise sogar zu widersprechen scheinen? Jedoch scheinen sie an anderen Orten voneinander abgeschrieben zu haben. Die ersten vier Bücher des Neuen Testaments, die Berichte von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, werden in der Bibelwissenschaft „Evangelien“ genannt.
Die synoptischen Evangelien
Die ersten drei Evangelien tragen seit 1774 den Namen Synopse (griechisch: Zusammenschau). Seit dem 18. Jahrhundert nennt man Matthäus, Markus und Lukas einfach die Synoptiker. Liest man diese drei Evangelien zeitnah oder gar in einer Evangelienharmonie, so stellt man gewisse Gemeinsamkeiten fest. Im Vergleich oder eben in der Synopse ähneln sich die Evangelien zum Teil sehr stark. In der Auswahl, in der Anordnung und im Wortlaut der Texte sind diese Evangelien oft so eng miteinander verbunden, dass diese dreifache Überlieferung eine gemeinsame Betrachtung geradezu notwendig macht.
Das synoptische Problem
Nun, eine gewisse Abhängigkeit und Ähnlichkeit liegt auf der Hand; schließlich berichten die Evangelisten von den gleichen Ereignissen. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit wohl legitim und nachvollziehbar. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die literarischen Beziehungen zwischen den drei Evangelien sind zum Teil so eng, dass eine voneinander unabhängige Entstehung kaum möglich erscheint. Wie ist dieses merkwürdige Nebeneinander von Übereinstimmung und Differenz zu erklären? In der Alten Kirche hat man die Ähnlichkeit des griechischen Textes zwar bemerkt, aber nie als Problem empfunden. Dann trat Gotthold Ephraim Lessing auf die Bildfläche. Er war einer der ersten, der darin ein großes Problem sah. Seine Hypothese lautete: Das Matthäusevangelium ist das ursprünglichste und Lukas, Markus und die apokryphen Evangelien haben es als Quelle benutzt. Diese Hypothese wird in der Forschung auch als Urevangelienhypothese bezeichnet.
Die Zwei-Quellentheorie
Diese starke Sicht einer Abhängigkeit, wenn nicht gar Kopie, hat sich in die evangelische Forschung gemeißelt wie ein Bildhauer seinen Stein behaut. Sie ahnen vielleicht schon, in welche Richtung sich die Forschung seit Lessing entwickelt hat. Zwar wurde die Markuspriorität (Nicht mehr Matthäus) in der Forschung bald Konsens, aber das synoptische Problem blieb natürlich bestehen. Die aktuellste Forschung geht von einer sogenannten Zwei-Quellentheorie aus. Darin gäbe es die beiden Hauptquellen Q und das Markusevangelium, wobei Lukas und Matthäus auf diese beiden Quellen zurückgegriffen hätten. Bei einer Abweichung geht man dann von einer weiteren, eigenen Quelle aus.
Die Relevanz der synoptischen Evangelien
Wenn nun ein Evangelist von einem anderen abschreibt, kann er kaum selbst als Augenzeuge berichten. Warum sonst sollte er sich einer anderen Quelle bedienen? Und wenn selbst ein Matthäus und ein Lukas mit dem kürzesten Bericht des Markus kritisch umgehen, gibt uns das nicht die Legitimation, das auch heute zu tun? Und so komme ich mit dieser Rezension zum ersten Zitat von Eta Linnemann, wenn sie im Vorwort schreibt:
„Aus der unterstellten Eigenmächtigkeit dieser Evangelisten wird nicht nur auf ein ähnliches Verfahren bei Markus zurückgeschlossen, sondern die historisch-kritischen Theologen leiten daraus auch das Recht ab, selber eigenmächtig mit Gottes Wort umzuspringen.“ (Linnemann, 1999:11).
Die Klärung und Beantwortung der synoptischen Frage ist automatisch mit der Frage nach dem kritischen Umgang mit dem Wort Gottes verbunden. In der evangelischen Forschung ist die synoptische Frage und deren Beantwortung ein Eckpfeiler der historisch-kritischen Methode. Aber ist das die einzige Antwort auf die synoptische Frage? Ich möchte Sie nun auf eine Reise durch Linnemann’s Buch und ihre Argumentationskette mitnehmen. Versuchen Sie dabei, so objektiv, kritisch und misstrauisch wie möglich zu sein. Ob man eine solche Haltung nicht nur bei menschlichen Texten, sondern auch gegenüber dem Wort Gottes einnehmen darf oder gar muss, wird sich vielleicht im Laufe der Rezension noch herausstellen. Doch bevor ich auf diese Argumentation eingehe, möchte ich die Autorin und ihre Tradition selbst vorstellen.
Eta Linnemann
Eta Linnemann (1926–2009) war evangelische Theologin. Sie studierte in Marburg, Tübingen und Göttingen. Einige Jahre später, um 1970, habilitierte sie sich bei Rudolf Bultmann und Ernst Fuchs. Beide Professoren sind für ihre historisch-kritische Methode der Bibelauslegung bekannt. Linnemann erregte 1978 Aufsehen, als sie sich aufgrund eines Bekehrungserlebnisses von der konsequenten historisch-kritischen Methode lossagte und um die Vernichtung ihrer bisherigen Veröffentlichungen bat. Von da an blieb sie zwar in der neutestamentlichen Forschung, nannte ihre Theologie aber Biblische Theologie. Damit ist sie methodisch mit Gerhard Maier und Helge Stadelmann der protestantisch-evangelikalen Bibelwissenschaft zuzuordnen.
Ihre Publikationen
Eta Linnemann hat sich seit ihrer Abkehr von ihrem Lehrer Bultmann stark dafür eingesetzt, Laien und Theologen die möglichen Schattenseiten der historisch-kritischen Methode vor Augen zu führen. In ihren folgenden Publikationen stellt sie jeweils ein bestimmtes Thema der historisch-kritischen Methode und der biblisch-erneuerten Theologie gegenüber.
- Original oder Fälschung. CLV, Bielefeld, 1994, 6. Auflage
- Bibelkritik auf dem Prüfstand. Verlag für Theologie und Religionswissenschaft (VTG), Nürnberg 1998
- Gibt es ein synoptisches Problem?. VTG, Nürnberg 1999, 4. Auflage
- Wissenschaft oder Meinung? VTG, Nürnberg 1999, 2. Auflage
- Bibel oder Bibelkritik? VTG, Nürnberg 2007
Die historisch-kritische Methode
Spätestens jetzt bin ich Ihnen eine Definition schuldig. Ich mag eine definitive Definition gerade in so Bereichen nicht, weil sie für gewöhnlich nicht in einem Konsens steht. In aktueller Debatte sei diese Sachlage am Wort Person gezeigt. Wie man dieses deutsche Wort Person definiert endet letztlich darin, wie man über Geschlechter und gar die mögliche Legitimation von Abtreibung denkt. Wann beginnt ein Mensch (oder eben ein ungeborenes Kind/Embryo), ein Mensch zu sein? Sobald also von Person die Rede ist, sei es im politischen Kontext oder in der kirchlichen Ethikdebatte, stellt sich die Frage, wie dieser Begriff zu definieren ist.
Modernes Methodenbündel
Übertragen auf dieses Methodenbündel der Bibelwissenschaft, ist es auch schwierig, die Wortgruppe historisch-kritische Methode zu definieren. Eine brauchbare Arbeitsdefinition liefert Werner Georg Kümmel in seiner Theologie des Neuen Testaments. Er stellt darin fest, dass sich
„In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der geistigen Bewegung der Aufklärung innerhalb der protestantischen Theologie die Erkenntnis durchzusetzen begann, dass die Bibel ein von Menschen geschriebenes Buch sei, dass wie jedes Werk menschlichen Geistes nur aus der Zeit seiner Entstehung und darum nur mit den Methoden der Geschichtswissenschaft sachgemäß verständlich gemacht werden könne.“ (Kümmel, 1980:12)
Es sind also bestimmte Auslegungsregeln, die seit der Aufklärung als vorherrschende Methode in der evangelischen (und teils auch katholischen) Bibelwissenschaft durchgedrungen sind. Ihr Höhepunkt erreichte die historisch-kritische Methode wohl mit Rudolf Bultmann (1884–1976).
Entmythologisierung der Bibel
Seine konsequente Methode der Entmythologisierung der Bibel beruht auf der Grundlage, die Bibel mit allen in der Moderne zur Verfügung stehenden Methoden zu interpretieren. Durch das neue, moderne Weltbild seit Galilei konnte vieles (natürlich bei weitem nicht alles) logisch erklärt werden. Dieser logische Anspruch sollte nun auch auf die Bibel übertragen werden. In der Konsequenz schaffte man das Wunderverständnis ab. Bultmann wollte die Bibel als moderner Mensch lesen und verstehen. Aber diese Wunder, in ihrem Höhepunkt natürlich die leibhafte Auferstehung eines Gottessohnes, der Mensch und Gott zugleich sein sollte, passten nicht in sein modernes Weltbild. Doch hören Sie selbst die Worte Bultmanns:
„Diese Geschlossenheit (der Geschichte) bedeutet, dass der Zusammenhang des geschichtlichen Geschehens nicht durch das Eingreifen übernatürlicher, jenseitiger Mächte zerissen werden kann, dass es also kein Wunder in diesem Sinne gibt. Ein solches Wunder wäre ja ein Ereignis, dessen Ursache nicht innerhalb der Geschichte läge.“ (Bultmann, 1957:143).
Bultmann entmythologisierte also die Bibel, indem er alle Wunder einfach wegerklärte. Die Plagen in Ägypten (Exodus) hatten bei ihm plötzlich naturwissenschaftliche Erklärungen. Eine solche konsequente Bibelkritik endete grösstenteils mit Bultmann.
Die Alternative: Eine biblisch-erneuerte Theologie
Neuere evangelische Theologen wie Peter Stuhlmacher, Armin Sierszyn, Gerhard Maier und eben Eta Linnemann sahen die Einseitigkeiten und Fehler der Methode, so dass sie zu den Begründern einer biblischen Theologie gezählt werden können. Eine Auslegungsmethode, die zwar die Bibel in Ort und Zeit mit vielen der zur Verfügung stehenden Auslegungsmethoden auslegt, aber Gott und sein Wirken nicht unbedingt in ein modernes Weltbild pressen muss. Eine Methode, die letztlich Gott Gott sein lässt. Zudem eine Methode, die Wunderberichte als historische Gestalt wahrnehmen und glauben kann. Passend und fast prophetisch hat es Karl Barth bereits 1922 in seinem Vorwort zum Römerbrief geschrieben:
„Die historisch-kritische Methode hat ihr Recht, sie weist hin auf eine Vorbereitung des Verständnisses, die nirgends überflüssig ist. Aber wenn ich wählen müsste zwischen ihr und der alten Inspirationslehre, ich würde entschlossen zu der letzteren greifen: sie hat das grössere, tiefere und wichtigere Recht, weil sie auf die Arbeit des Verstehens selbst hinweist, ohne die alle Zurüstung wertlos ist. Ich bin froh, nicht wählen zu müssen zwischen beiden. Aber meine ganze Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, durch das historische hindurch zu sehen in den Geist der Bibel, der der ewige Geist ist.“ (Barth, 1922:7).
In derselben Tradition ist nun Linnemann einzuordnen, wenn sie schreibt:
„Wir sollten deshalb nicht mehr länger die sogenannten „wissenschaftlichen“ Ergebnisse der Theologie leichtgläubig für bare Münze annehmen, denn „wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch (ihre) Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Laßt uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus (Eph 4,14–16).“ (Linnemann, 1999:11).
Falls Sie sich entscheiden, ihr Buch zu lesen, werden sie all dass vertieft kennenlernen. Für diejenigen, die jedoch nur der Grobüberblick verlangen, muss das gesagte genügen. Nun möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise in die synoptische Frage.
Eine Reise beginnt
Für die Beantwortung der synoptischen Frage stellt Linnemann vier Fragen auf, die als Hauptkapitel für ihr Buch dienen. Diese vier Fragen beantwortet sie natürlich ausgiebig. Sie lauten:
- Wie wissenschaftlich ist die wissenschaftliche Theologie?
- Besteht eine literarische Abhängigkeit zwischen den drei synoptischen Evangelien?
- Können die drei synoptischen Evangelien unabhängig voneinander entstanden sein?
- Wozu haben wir vier Evangelien, und wie gehen wir damit um?
Die erste wurde in diesem Beitrag bereits, auch wenn nur knapp, beantwortet. Linnemann zeigt im ersten Kapitel detailliert auf, wie die Hypothesen der Forschungen lauten. Sie überprüft die Hypothesen und kommt zum Schluss, dass die bisher gängige Zwei-Quellentheorie nicht haltbar ist mit der aktuellen Forschungsergebnissen (Seite 13–50). Somit kommt sie zum Fazit des ersten Kapitels, wenn sie schreibt:
„Es ist deshalb an der Zeit, die Frage nach dem sogenannten synoptischen Problem und seiner Lösung noch einmal neu anzugehen.“ (Linnemann, 1999:51).
Und genau das will ich nun mit Ihnen tun.
Besteht eine literarische Abhängigkeit zwischen den drei synoptischen Evangelien?
Dass es eine Abhängigkeit gibt, war lange Konsens. Doch genau diese grundlegende Frage ist Linnemann sehr wichtig. Denn wenn es keine Abhängigkeit gibt, besteht auch das synoptische Problem nicht mehr. So folgert Linnemann für die neutestamentliche Wissenschaft:
„Sollte sich erweisen, daß keine literarische Abhängigkeit zwischen den drei synoptischen Evangelien besteht, dann wäre etwa vierzig Prozent der neutestamentlichen Forschung, die innerhalb der historisch-kritischen Theologie praktiziert wird, der Boden unter den Füßen weggezogen. Das darf uns aber nicht daran hindern, die Frage anhand der Befunde objektiv und gewissenhaft zu beantworten.“ (Linnemann, 1999:53)
Linnemann’s Hauptargument besteht darin, als dass sie die inhaltliche Übereinstimmung nicht mit einer literarischen Abhängigkeit gleichsetzt. Die inhaltliche Übereinstimmung der synoptischen Evangelien ist ein Fakt. Doch die Ursache dafür muss nicht literarischer Art sein, sie kann auch historisch vermittelt sein. Nicht nur Berichte, welche dieselbe literarische Quelle benutzen, weisen inhaltliche Gemeinsamkeiten auf, sondern voneinander unabhängige Berichte über dasselbe Ereignis tun das ebenso. Linnemann bringt dafür Beispiele aus dem Alltag. Man könnte beispielsweise verschiedene Sportberichte über dasselbe Fussballereignis oder Zeugenaussagen über den gleichen Verkehrsunfall miteinander vergleichen. Eine solche Übereinstimmung ist also nicht literarisch zu verorten, sondern vielmehr historisch. Dies ist deshalb so, weil die Berichterstattung nicht aufgrund literarischen Quellen, sondern im ersten Fall auf direkter Berichterstattung, im zweiten Fall aufgrund unabhängiger Zeugenaussagen beruht.
Ursprung der inhaltlichen Übereinstimmung
In mehreren Arbeitsgängen untersucht Linnemann folglich, ob die inhaltliche Übereinstimmung an einer literarischen oder eben einer historischen Abhängigkeit zugrunde liegt (Seite 54–120). Ihr Fazit zur inhaltlichen Gemeinsamkeit bei den synoptischen Evangelien lautet folglich:
- „Die Ergebnisse (der inhaltlichen Übereinstimmung) können auch dadurch zustande gekommen sein, daß die gemeinsame Erzählfolge auf die Reihenfolge der berichteten Ereignisse zurückgeht. Dafür spricht die fast lückenlose Gemeinsamkeit in der Passions- und Ostergeschichte, wo die Reihenfolge der Ereignisse sachlich zwingend ist.“ (Linnemann, 1999:117).
- Die Ergebnisse der sprachlichen Übereinstimmung (als die exakt gleiche Wortfolge) sind vergleichsweise gering und erstrecken sich in erster Linie auf die übereinstimmende Wiedergabe von Jesusworten sowie auf das von der Sache her vorgegebene und nicht austauschbare Vokabular. Dieser Befund ist unter der Voraussetzung freier, gleichursprünglicher Formulierung desselben Sachverhaltes völlig normal.
Somit stellt Linnemann fest, dass die literarische Beziehung der Evangelien kein Fakt ist. Wenn die inhaltliche Übereinstimmung nicht literarischer Art ist, müssten die Evangelien unabhängig voneinander entstanden sein. Also genauso wie die Sportberichte oder die Zeugenaussagen separat entstanden sind, so auch die synoptischen Evangelien.
Können die drei synoptischen Evangelien unabhängig voneinander entstanden sein?
In diesem Kapitel untersucht Linnemann weitere Parallelperikopen aus den synoptischen Evangelien. Nach objektiver Prüfung der Daten kommt sie zu einer möglichen Bejahung der Frage. Die synoptischen Evangelien sind wahrscheinlich gleichursprüngliche Berichte, denn die Unterschiede in den Parallelen sind nichts anderes als das zu erwartende Ergebnis einer sogenannten perspektivischen Sichtweise, mit der bei Augenzeugen zu rechnen ist. Kleinere Abweichungen sind normal, überzählige Verse sind als Zusatzinformation zu werten.
Doch dann könnte ein Kritiker einwenden: Wie sind denn die drei synoptischen Evangelien entstanden, wenn zwischen ihnen keine literarische Abhängigkeit besteht? Diese Frage sprengt leider den Rahmen dieser Rezension. Sie ist nämlich tief mit der historisch-kritischen Methode verwoben. Um sie zu beantworten, bedarf es profunder Kenntnisse der Redaktionsgeschichte, der Traditionsgeschichte ( bzw. Formgeschichte), der historischen Jesuserzählung (ipissima verba jesu) und anderer Methoden der Bibelwissenschaft. Wer sich damit beschäftigen will, tut gut daran, ihr Buch zu lesen. Ein Ratgeber und Helfer in der Not ist dann vielleicht noch das Buch aus Ihrer Stadtbibliothek: Evangelische Schriftauslegung (Hrsg. Joachim Cochlovius und Peter Zimmerling, TVG. 1987). Zum Abschluss dieser synoptischen Fragestellung soll aber, wie Linnemann ihr Buch abschließt, ein Blick in die Praxis geworfen werden.
Wozu haben wir vier Evangelien, und wie gehen wir damit um?
Eigentlich ist es ein Vorrecht, vier verschiedene Berichte von den Taten, Leiden und Worte Jesu zu haben. Gottes Absicht dahinter ist liegt in einem Prinzip begründet, welches man im 5. Mose Buch findet: „⟨Nur⟩ auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein.“ – Dtn 19,15b
Linnemann schreibt begeistert von diesen vier Evangelien, wenn sie sagt:
„Gott, der weiß, daß wir auf das Zeugnis derer angewiesen sind, die Jesus selber gesehen und gehört haben, hat dafür gesorgt, daß die frohe Botschaft, an der unser Heil hängt, uns mehrfach überliefert wurde, wobei die unabhängigen Zeugen sich wechselseitig bestätigen.“ (Linnemann, 1999:146).
Man darf diese Berichte schätzen lernen wie Linnemann das getan hat. Sie dürfen mit Methoden eine Perikope untersuchen und zu einer Glaubensaussage kommen. Ein biblisches Buch zu nehmen und seine Hauptaussage mit Einzelperikopen vergleichen, was fürt eine schöne Arbeit! Was hat Markus beispielsweise mit seinen Wunderberichten beabsichtigt? Oder was sagt der Lukasprolog über die restlichen Kapiteln seines Berichtes? Man darf und soll diese Berichte untersuchen!
Fazit und Schlusswort
Dieser Forschungsbericht von Linnemann war ein intensiver und zeitaufwendiger Brocken, der sich zumindest für mich gelohnt hat. Ich konnte in ein tieferes Verständnis der Evangelien eintauchen und habe systematische und apologetische Erkenntnisse gewonnen. Ich kann es jedem empfehlen, der an neutestamentlicher Forschung interessiert ist und regelmäßig aus den Evangelien predigt.
Die Bibel und besonders die synoptischen Evangelien halten tatsächlich nicht aller Kritik stand. Das heisst jedoch noch lange nicht, dass sie nicht glaubwürdig wären. Glaubwürdig meint ja, dass sie es verdient, geglaubt zu werden. Das heisst nicht, dass man mit modernen Auslegungsmethoden alle Berichte der Bibel erklären kann. Glaubwürdig heisst nicht, dass sie nur durch die historisch-kritische Methode gelesen werden darf. Das Wort Glaubwürdig heisst einfach: Es ist würdig, dass man daran glaubt.
Was der Evangelist Johannes in Joh 20,31 als sein Buchziel definiert, weite ich auf alle Evangelien, ja gar auf die ganze Bibel aus:
„Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben.“
Bibliographie
Barth, Karl. Der Römerbrief, Theologischer Verlag Zürich. 1922.
Bultmann, Rudolf. „Ist voraussetzungslose Exegese möglich?“. In: Glauben und Verstehen, Bd. 3, Paul Siebeck Verlag. Tübingen. 1957.
Kümmel, Werner Georg. Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen. NTD Reihe Band 3, Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen. 1980.
Linnemann, Eta. Gibt es ein synoptisches Problem? (5. verbess. Aufl.), VTR. 2012.

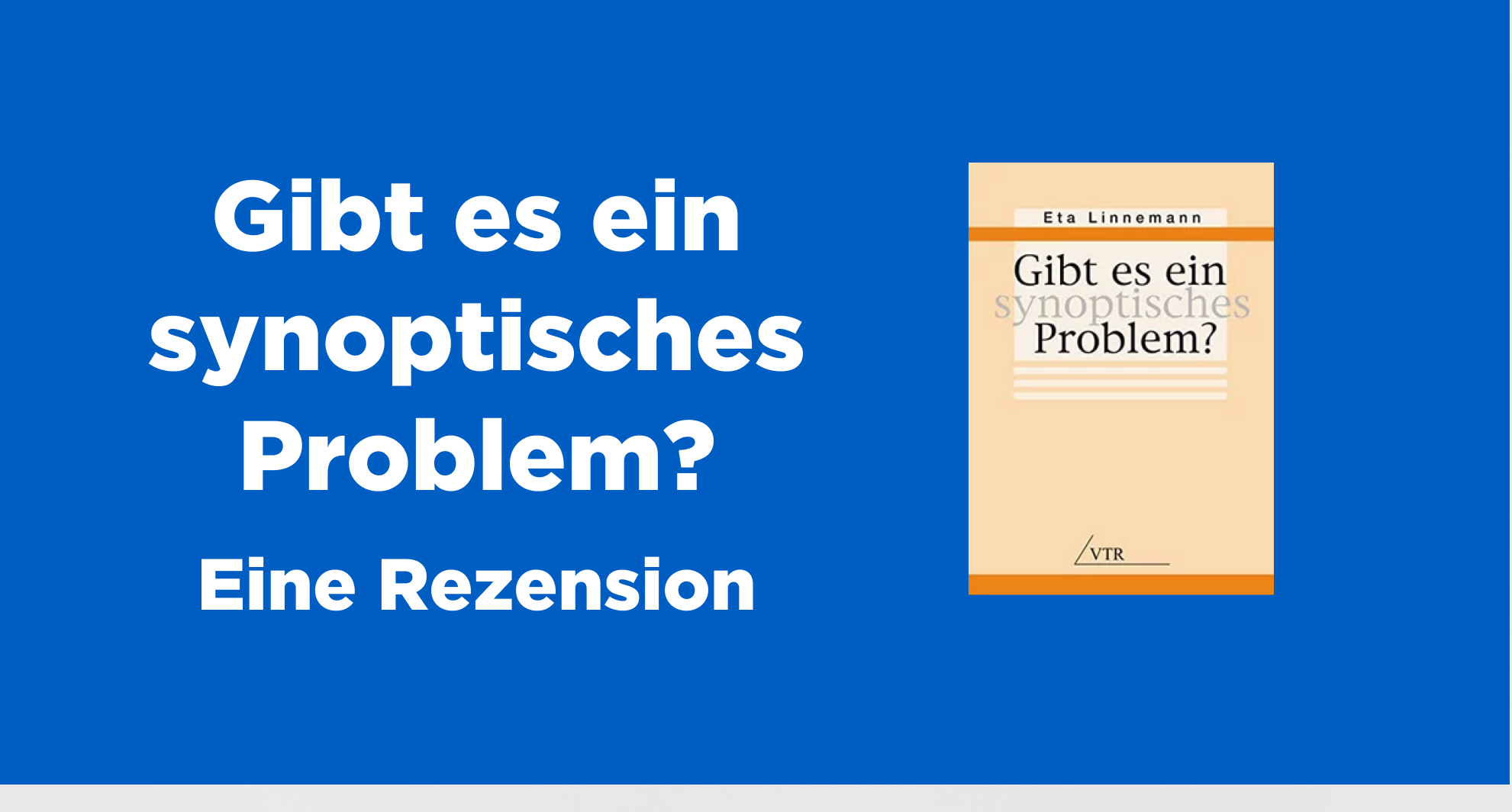



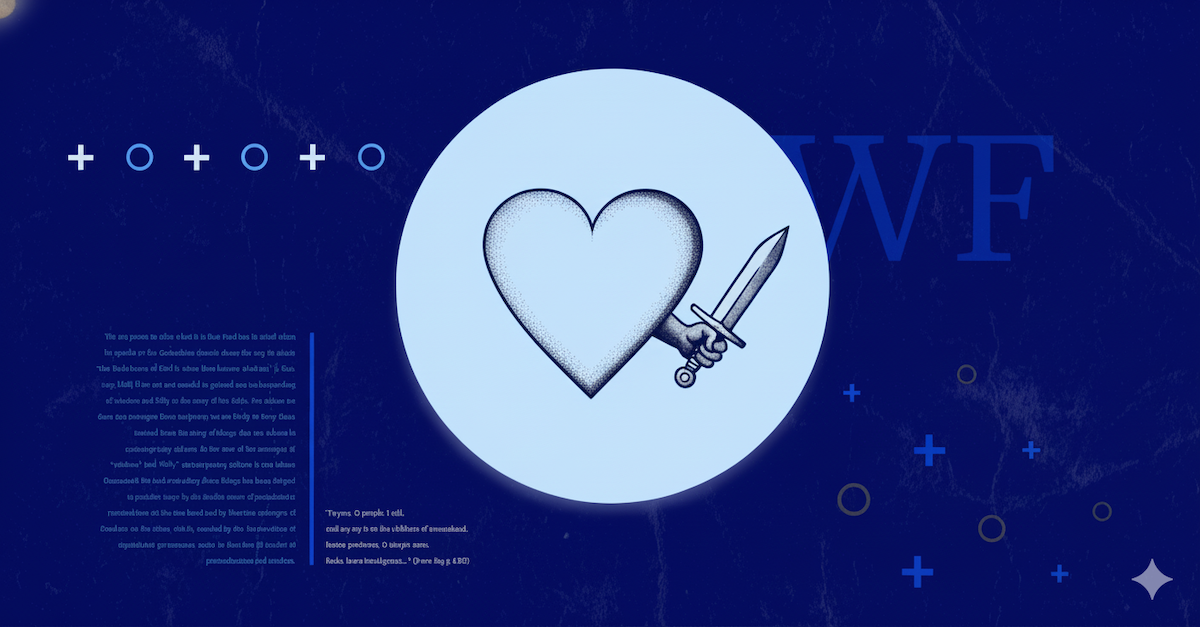
Leider wird von vielen Seiten immer wieder das kräftige Zeugnis der Kirchenväter für einen aramäischen Matthäus als allererste Evangeliumsschrift missachtet. Laut Eusebius von Cäsarea: „Matthäus hat in
hebräischer Sprache die Reden zusammengestellt; ein jeder aber übersetzte dieselben so gut er konnte.”
Das würde also bedeuten, dass viele Menschen, inkl. Mk und Lk den aram. Mt kannten und ihn für sich übersetzten, bis später dann jemand die aram. Ausgabe vollständig ins griech. übersetzte.
So braucht es weder 2–4 Quellen (von denen nichts erhalten ist und die auch nirgends bezeugt werden), noch eine Erkläsung gemäss Linnemann für das synop. Problem (welches eigentlich gar keines ist).
Freilich ist die aram. Mt-Schrift auch nicht erhalten, dennoch ist sie in der frühen Kirche sehr stark bezeugt. Bei den Schriften von Papias von Hierapolis ist es doch auch akzeptiert: sie sind nicht mehr erhalten, doch ihr Zeugnis bei den anderen KV reicht, um ziemlich sicherzugehen, dass es sie gab.….
Hallo Markus
Vielen Dank für dein Kommentar. Wie du richtig feststellst, geht auch Linnemann davon aus, dass wir mit ihrem Blickwinkel eigentlich gar nicht von einem Problem reden müssen. Dasselbe trifft natürlich auch auf deine aramäische Urevangeliumshypothese zu.
Deine Quelle ist absolut korrekt und wird definitiv zu wenig beachtet. Ich wünsche mir für solche Debatten und Einleitungsfragen auch mehr den Blick und die Stimme der Kirchenväter, wo sie doch so nah dran waren! Deine Theorie wird ja beispielsweise auch vom Neuttestamentler Erich Mauerhofer unterstützt. Obwohl auch diese Theorie eine Theorie bleibt, oder?
Ob wir nun eine Matthäus-Priorität oder eine andere Hypothese bevorzugen, wir dürfen nebst und gerade durch die Forschung am biblischen Bericht festhalten, welcher auch im 21. Jahrhundert noch gebraucht und geschätzt wird!