Ausführlich, kontrovers, packend! All diese Worte beschreiben die „Dogmatik“ des beliebten Theologen Wilfried Härle. Diese Buchrezension hilft Ihnen in 12 Minuten einen guten Einblick in dieses wichtige Werk zu bekommen.
Inhalt
Umfassend, vielseitig und doch einfach verständlich
Das Buch „Dogmatik“ von Wilfried Härle ist eine beeindruckende und umfassende Einführung in die christliche systematische Theologie. Der Autor, ein renommierter Theologe, hat ein Werk geschaffen, das sich an Studierende, Pastoren und alle interessierten Christen richtet, die ein tieferes Verständnis der dogmatischen Lehre suchen. Der Autor bietet einen klaren und verständlichen Überblick über die relevanten theologischen Themen und Debatten, die das christliche Glaubensverständnis geprägt haben. Dabei stellt er die theologischen Konzepte und Begriffe übersichtlich dar und bietet eine gründliche Analyse der zugrunde liegenden theologischen Argumente.
Das Buch zeichnet sich durch eine systematische und kohärente Struktur aus, die dem Leser ermöglicht, die verschiedenen Aspekte der Dogmatik in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Besonders bemerkenswert ist, dass Härle sich nicht nur auf die traditionelle christliche Dogmatik beschränkt, sondern auch zeitgenössische theologische Debatten und Entwicklungen berücksichtigt. Das macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für alle, die sich für die christliche Theologie interessieren.
Härle schreibt in einem klaren und verständlichen Stil und vermeidet es, komplexe theologische Begriffe zu verwenden, ohne sie zu erklären. Er greift auf eine breite Palette von Quellen zurück, von der Schrift bis hin zu historischen Theologen und zeitgenössischen Denkern, und liefert zahlreiche Beispiele und Illustrationen, um den Lesern das Verständnis des Materials zu erleichtern. Weiterhin gibt er auch immer wieder Hinweise auf weiterführende Literatur, die es dem Leser ermöglicht, sich intensiver mit bestimmten Themen zu beschäftigen.
Logos bietet die neuste erweiterte und überarbeitete Edition (die 6. Auflage) von Härles Dogmatik, welche neue Kapitel enthält (z.B. „Das Verhältnis zwischen Gott und der Welt“), Überarbeitungen und eine erweiterte Bibliografie. Die zahlreichen Nachdrucke des Buches sind ein Hinweis auf seine große Beliebtheit.
Der Autor
Wilfried Härle (*6. September 1941 in Heilbronn) ist ein deutscher evangelischer Theologe und war von 1978 bis 1995 Professor für Theologie an der Philipps-Universität Marburg und von 1995 bis 2006 Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Wilfried Härle studierte Evangelische Theologie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Im Jahr 1969 promovierte er an der Ruhr-Universität Bochum zum Doktor der Theologie. Seine Dissertation trug den Titel: Die Theologie des „frühen“ Karl Barth in ihrem Verhältnis zu der Theologie Martin Luthers. 1973 folgte die Habilitation für Systematische Theologie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel zum Thema Sein und Gnade – die Ontologie in der kirchlichen Dogmatik Karl Barths.
Von 1977 bis 1978 hatte Härle einen Lehrauftrag an der Universität Groningen in den Niederlanden, bevor er 1978 einen Ruf an die Philipps-Universität Marburg erhielt, wo er bis 1995 eine Professur innehatte. Von 1995 bis 2006 war Härle Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg.
Praktisch und kontrovers
Die vielen Anwendungsbeispiele in Härles Dogmatik helfen die Bedeutung der dogmatischen Lehre zu veranschaulichen und zu verdeutlichen. Zudem zeigt er immer wieder die praktische Relevanz der Dogmatik auf und verbindet diese mit dem christlichen Leben. Im gesamten Buch betont er, dass Theologie keine abstrakte oder irrelevante akademische Disziplin ist, sondern tatsächlich Auswirkungen darauf hat, wie Christen leben und mit den Menschen in ihrem Umfeld umgehen.
Ein weiterer positiver Aspekt des Buches ist, dass Härle auch kontroverse Themen behandelt, wie beispielsweise die Frage nach der Existenz der Hölle und Fragen der Endzeit. Dabei geht er auf die verschiedenen theologischen Positionen ein und gibt dem Leser die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. Er zeigt auf, dass christliche Theologie oft keine dogmatische Festlegung ist, sondern dass es Raum für kritische Reflexion und Diskussion gibt.
Ein kleiner Kritikpunkt könnte sein, dass das Buch an vereinzelten Stellen zu ausführlich wird und sich in Details verliert. Dies kann dazu führen, dass der Leser sich von der Informationsflut überfordert fühlt, aber dabei handelt es sich nur um wenige Ausnahmen. Dennoch ist es dem Autor gelungen, ein Werk zu schaffen, das umfassend und gleichzeitig verständlich ist.
Der Aufbau des Buches
Das Buch gliedert sich in fünf Teile. Härle beginnt mit einem einleitenden Kapitel, in dem er die Dogmatik im Gesamtzusammenhang der Theologie als Wissenschaft betrachtet. Hier legt er wichtige Grundlagen und erklärt das Wesen von systematischer Theologie und deren Platz in der akademischen Welt.
Im ersten Hauptteil rekonstruiert Härle das Wesen des christlichen Glaubens. Er durchdenkt die weitreichenden Auswirkungen davon, dass Jesus die höchste Offenbarung Gottes ist, begründet die zentrale Rolle der Bibel für den christlichen Glauben, erläutert die Rolle christlicher Glaubensbekenntnisse und diskutiert, welche Rolle die gegenwärtige Lebenswelt für den christlichen Glauben spielt.
Im zweiten Hauptteil klärt Härle das christliche Verständnis von Wirklichkeit und beleuchtet es anhand von damit verknüpften Themen.
Unser Verständnis von Gott prägt maßgeblich unser Theologisieren. Deshalb verwendet Härle viel Zeit und Kraft im Teil A seines Buches, um das christliche Gottesverständnis detailliert zu untersuchen. Dieser Teil dient als Grundlage für alle seine weiteren Ausführungen und umfasst die Bereiche Theologie, Christologie, Pneumatologie und die Trinitätslehre.
Aufbauend auf seinen Gedanken in Teil A, konstruiert Härle ein solides christliches Weltverständnis im Teil B seines Buches. Kein Bereich kommt dabei zu kurz. Ausführlich behandelt Härle die Schöpfungslehre, Hamartiologie, Soteriologie und Eschatologie.
Gottes Wesen als Liebe
Eine der Besonderheiten von Härles Dogmatik ist, dass er Gottes Wesen als Liebe versteht und die Bedeutung dessen konsequent weiterdenkt in allen anderen Bereichen seines Buches. Härle bringt diesen Ansatz in seinem Buch gut auf den Punkt:
Die Erkenntnis des Wesens Gottes, die aus der Person und dem Werk Jesu Christi gewonnen ist, läßt sich verdichten in dem Satz: „Gottes Wesen ist Liebe“.
Im Hintergrund dieses Satzes steht natürlich die biblische Aussage: „Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8 u. 16). Aber die Tatsache, daß es in der biblischen Überlieferung eine solche – geradezu definitorisch klingende – Aussage gibt, rechtfertigt für sich genommen noch nicht ihre Übernahme als Wesensbestimmung Gottes. Wenn man hier biblizistisch für 1 Joh 4 argumentieren würde, müßte man damit rechnen, daß andere mit gleichen Mitteln gegen die Verwendung dieser Stelle Bedenken anmelden könnten: Verbietet nicht die Tatsache, daß dieser Satz so nur im 1. Johannesbrief vorkommt, aus ihm eine Wesensbestimmung Gottes abzuleiten oder zu machen?
Aber in der Aussage: „Gott ist Liebe“ verdichtet sich eine Fülle biblischer, kirchlicher und theologischer Aussagen über Gott. D.h., sie ist trotz der Einzigartigkeit ihrer Formulierung keineswegs eine isolierte, einmalige, sozusagen zufällige Aussage, sondern bringt – im Blick auf das Wesen Gottes – das Wesentliche des christlichen Gottesverständnisses zum Ausdruck. Für viele Christen ist sie – aus diesem inhaltlichen Grund – die kostbarste Aussage des christlichen Glaubens. (Härle 2022:238–239).
Allerdings ist Härle sich sehr bewusst, daß gerade dieser Satz „Gott ist Liebe“ sowie der Begriff „Liebe“ zu den häufig mißverstandenen, mißbrauchten und trivialisierten Aussagen und Begriffen gehört. Im Lichte davon, dass Begriffe mit Sicherheit nicht die am besten geeigneten Mittel zur Beschreibung Gottes sind betont Härle:
In Jesus Christus, der als inkanierter Logos mit Gott wesenseins ist, nimmt Gottes Wesen menschliche Natur und Gestalt an und offenbart sich insofern in einer irdischen, menschlichen, endlichen Person. Von Jesus Christus kann gesagt werden: er ist die göttliche Liebe in Person. (:255)
Indem er den Begriff der Liebe mit Blick auf das Leben und die Lehre Jesu füllt, wendet Härle diese Grundlage konsequent auf seine gesamte Theologie an und setzt damit Jesus in das Zentrum all seiner Theologie.
Härle schafft es Gottes Wesen als Liebe zu definieren, ohne dabei Kompromisse einzugehen, mit Gottes Heiligkeit oder dem kommenden Gericht. Ausführlich betrachtet er Gottes Zorn und Gottes Heiligkeit im Hinblick auf Gottes Wesen als Liebe.
Denn wenn nicht ehrlich gesagt werden kann, Heiligkeit und Zorn seien Eigenschaften der Liebe Gottes, dann liegt über dem Gottesbild ein Schatten, der geeignet ist, alles zu verdunkeln (:270).
Wie passt Gottes Zorn zu dem Gott, dessen Wesen Liebe ist?
Härle macht klar, dass Gottes Zorn, welcher aus seiner Heiligkeit geboren ist, ein Ausdruck von Gottes Liebe ist. Er stimmt Otto Weber zu, der es gut auf den Punkt gebracht hat:
Der Zorn Gottes kann nur als Gottes wirkliches und wirksames Nein gegen die Sünde verstanden werden. Da aber die Sünde ihrerseits die Abweisung der Liebe Gottes ist …, so ist der Zorn Gottes nichts anderes als Gottes Liebe, die sich gegen ihre eigene Abweisung kehrt (:271).
So kommt Härle zu dem Schluss:
Der heilige Zorn bzw. die zornige Liebe Gottes richtet sich um des geliebten Menschen willen gegen alles, was ihm bzw. wodurch er sich selbst schadet. „Liebe“ ohne solchen heiligen Zorn wäre keine echte Liebe. Sie wäre im besten Fall Freundlichkeit, im schlimmsten Fall Gleichgültigkeit. Darum gehören die Eigenschaften der Heiligkeit und des Zornes zu dem Wesen Gottes, das Liebe ist (:271).
Das Evangelium neu durchdacht
Auch im Bereich der Soteriologie scheint Härles Grundlage, von Gottes Wesen als Liebe, durch, was zu spannenden Gedanken führt, was genau Jesus eigentlich durch das Kreuz und die Auferstehung bewirkt hat.
Härle beschreibt drei Schwierigkeiten (eine theologische, eine anthropologische und eine ethische Schwierigkeit), die er sieht, mit der weitverbreiteten Versöhnungslehre. Unter der Versöhnungslehre definiert er die Idee, dass Gott aufgrund seiner Heiligkeit nicht einfach vergeben kann, sondern Jesus als schuldloses Sühneopfer gebraucht hat, um seinen heiligen Zorn zu besänftigen und der sündigen Menschheit vergeben zu können, ohne dabei ungerecht zu sein.
Dies führt Härle dazu, diese Lehre neu zu durchdenken, die aktuelle Debatte um das Thema aufzugreifen und das Kreuz und die Auferstehung Jesu in einem differenzierteren Licht zu verstehen.
Dabei betont er, dass schon die Urgemeinde nur mit einer Mehrzahl von Bildern und Begriffen (Sühnopfer, Versöhnung, Stellvertretung, Loskauf etc.) versucht hat, die Bedeutung dieses Geschehens „für uns“ zur Sprache zu bringen. Alle in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe und Aussagen haben den Charakter von Metaphern, die möglicherweise einen entscheidenden Aspekt an diesem Geschehen erschließen, die aber falsch werden, wenn sie als Begriffe oder Aussagen im direkten, wörtlichen Sinn genommen werden.
Während er verschiedene Dimension des Kreuzes aufzeigt und so das Evangelium neu zum Leuchten bringt, betont er:
Wenn es in der christlichen Versöhnungslehre (jedenfalls in ihren biblischen Ausdrucksformen) so etwas wie eine schlechterdings grundlegende und unbeirrt festzuhaltende Einsicht gibt, dann ist es die, daß Gott selbst das Subjekt des Versöhnungsgeschehens ist. Gott wird nicht durch den Tod Jesu Christi zu einem versöhnten, gnädigen und liebenden Gott, sondern die „Sendung“ bzw. „Hingabe“ seines Sohnes (und d. h.: die Selbsthingabe Gottes) ist schon das Werk und Wirken der göttlichen Liebe (Joh 3,16; Röm 5,8; Gal 4,4f.; 1 Joh 4,9f. u. o.). Und darum steht im Zentrum der christlichen Versöhnungslehre der Gedanke, den Paulus in 2 Kor 5,19 zum Ausdruck gebracht hat in dem Satz: „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber“.
Aber gerade diese zentrale und unaufgebbare Einsicht scheint durch die objektive Versöhnungslehre gefährdet zu sein, weil in ihr der Eindruck entsteht, die Vergebung Gottes und die Versöhnung der Welt mit Gott werde erst ermöglicht durch das Leiden und Sterben Jesu Christi, durch das Gottes Zorn besänftigt, seiner verletzten Ehre genuggetan oder die gestörte Weltordnung wiederhergestellt werde. Mit all diesen Bildern und Formulierungen entsteht (möglicherweise wider Willen) das Bild eines Gottes, der nicht vergeben und sich versöhnen lassen will oder kann, ohne daß (ihm) zuvor das Opfer eines unschuldigen Menschenlebens dargebracht wurde. Diese Gottesvorstellung hat viel mit einem grausamen Despoten, aber nichts mit dem in Jesus Christus offenbarten Gott zu tun, dessen Wesen Liebe ist (:332–333).
Fazit
Insgesamt kann ich Härles „Dogmatik“ uneingeschränkt empfehlen. Es ist ein ausgezeichnetes Buch, das einen klaren und zugänglichen Einblick in die zentralen Lehren der christlichen Theologie bietet und gleichzeitig zum Nachdenken und zur kritischen Reflexion anregt.
Härles Buch fordert heraus, lädt ein, manche Bereiche der Theologie neu zu durchdenken und scheut sich auch nicht, kontroverse Themen (z.B. die Theodizee-Frage oder das Thema Hölle) ehrlich zu diskutieren.
Es ist eine wertvolle Ressource für Pastoren, Theologen und Laien gleichermaßen, und Härles klarer und ansprechender Schreibstil macht es zu einem Vergnügen zu lesen.
Die Logos-Edition des Buches ist komplett durchgängig verlinkt und ermöglicht so das schnelle Navigieren zwischen den Texten und das gründliche Durchsuchen des Buches. Das Buch ist enthalten in den Basispaketen ab Logos 10 Gold Silber (akademisch) und ab Logos 10 Gold.
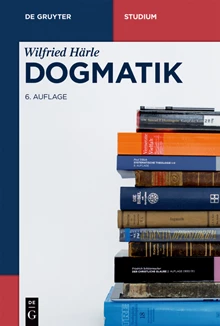
Bibliografie
Härle, Wilfried. Dogmatik. 6., durchgesehene, überarbeitete und bibliographisch ergänzte Auflage, De Gruyter, 2022, S. 238–39.

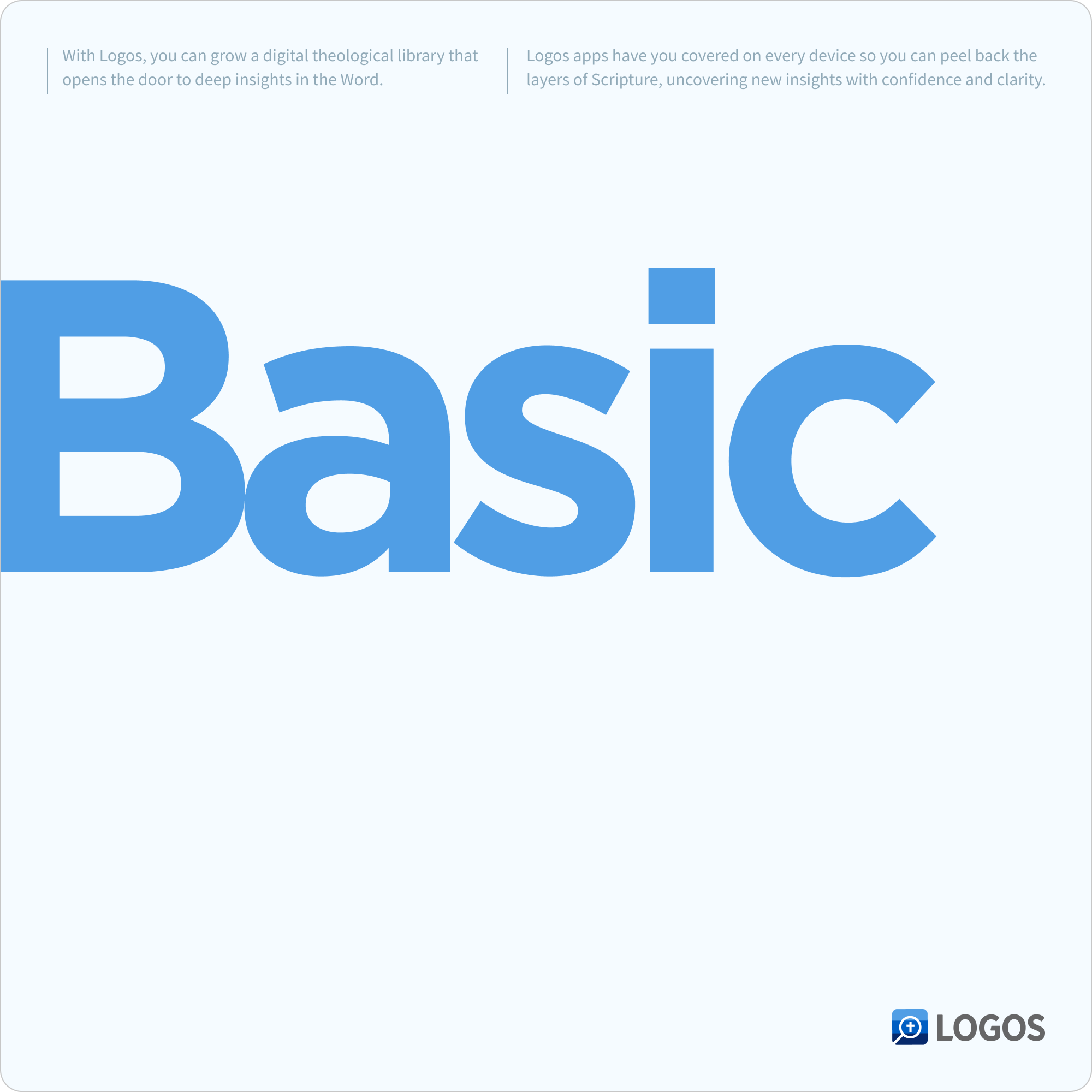
Leider kann ich die Zustimmung des Rezensenten zur Soteriologie Härles nicht teilen.
Härle blendet, wenn er das Evangelium „neu durchdenkt“, eindeutige biblische Aussagen vollständig aus. Zum Beispiel:
2. Mose 12,13: „Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen.“
Jesaja 53,5: „Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg; aber der HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld.“
Johannes 3,36: „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“
Hebräer 9,22: „Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung.“
Die biblisch-reformatorische Sühnelehre (von Härle „objektive Versöhnungslehre“ genannt) trägt all diesen Stellen angemessen Rechnung, ohne dadurch den Eindruck eines Gottes zu vermitteln „der nicht vergeben und sich versöhnen lassen will oder kann, ohne daß (ihm) zuvor das Opfer eines unschuldigen Menschenlebens dargebracht wurde.“
Dieses Zerrbild ist vielmehr von den Gegnern der biblisch-reformatorischen Sühnelehre entworfen worden: von der exegetischen Kritik (z. B. Bultmann), von der psychologischen Kritik und von der feministischen Kritik. Ein solches Bild hatten die Reformatoren nicht (Luther, Calvin – übrigens nicht einmal Anselm von Canterbury). Sie gingen vielmehr davon aus,
• dass Gott kein Opfer von den Menschen fordert, sondern selbst das Opfer stellt,
• dass also die Liebe Gottes der Ausgangspunkt der Versöhnung ist
• und dass Christus freiwillig bereit war, dieses Opfer zu sein.
Die biblisch-reformatorische Sühnelehre berücksichtigt allerdings nicht nur die Liebe, sondern auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes auf angemessene Weise. Sie erkennt an,
• dass nicht nur die Sünde Gegenstand des Zornes Gottes ist, sondern auch der unbekehrte Sünder,
• dass ein gerechter Gott, Sünden nicht einfach vergibt,
• dass Er aber in seiner Liebe den Sohn hingibt, der an unserer Stelle die Strafe auf sich nimmt, so dass sie uns nicht mehr trifft; das ist echte, biblische Stellvertretung,
• dass Gott also nicht nur Subjekt des Sühnegeschehens ist (Er stellt in seiner Liebe das Sühnopfer), sondern auch Objekt (die Ansprüche seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit werden erfüllt. – Das ist zusammengenommen echte, biblische Sühne.
Zu bedenken ist auch, dass voraussetzungslose Vergebung mit der Lehre von der Rechtfertigung in Widerspruch steht. Rechtfertigung geht über Vergebung hinaus. Die „neu durchdachte“ Sühnelehre kann dem nicht Rechnung tragen.
Eine mit ähnlicher Zielrichtung und ähnlichen Argumente „neu durchdachte“ Sühnelehre findet sich auch bei den Tübinger Theologen Gese, Janowski, Hofius und Stuhlmacher (und in popularisierter Form bei H. J. Eckstein).
Bei allen Spielarten einer „neu durchdachten“ Sühnelehre, besteht die Gefahr einer anderen „Gottesvorstellung“. Darin gebe ich Härle und dem Rezensenten Recht.
Sehr geehrter Herr Vogel,
Vielen Dank für das ausführliche und durchdachte Kommentar. Ich schätze das. Spannende Gedanken. Die Kommentare unter einem Blog sind sicher nicht der praktischste Rahmen, um tiefe biblische Grundlagen zu diskutieren, die seit Jahren Streitpunkt unzähliger theologischen Diskussionen unter den Gelehrten sind. Aber ich will trotzdem versuchen, ein paar (hoffentlich hilfreiche) Gedanken zu formulieren zu Ihren angeführten Punkten. Ich stimme ganz sicher nicht allem, was Härle sagt, uneingeschränkt zu, aber ich denke doch, dass seine Argumentation teilweise schlagkräftige Punkte enthält, die bedacht werden müssen. Sie haben mehrere umfangreiche theologische Themen angerissen und es würde den Rahmen hier sprengen, diese alle in der Tiefe zu beantworten, deshalb will ich mich auf ihren ersten Punkt beschränken, der für das Thema zentral ist und meine Gedanken dazu teilen.
Ist Blut (oder ein Opfer) nötig zur Vergebung von Schuld?
Ihr erster Punkt betont Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass Blut nötig ist zur Vergebung der Schuld. Hebräer 9,22 scheint diese Frage ganz klar zu beantworten. Tatsächlich gibt es unzählige Bibelstellen, die genau darauf hindeuten. Allerdings ist das Gegenteil auch wahr. Es gibt eine große Anzahl an Stellen, die aussagen, dass Opfer und Blut keine Sündenvergebung bewirken. Das Thema ist etwas komplex.
In der evangelikalen Gemeinde, in der ich aufwuchs, lernte ich, dass Gott nicht einfach vergeben kann, weil er ein gerechter Gott ist. Mir wurde gesagt, dass Gott das Opfer Jesu gebraucht hat, um vergeben zu können, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung (Hebr 9,22). Deshalb musste Jesus am Kreuz sterben, damit wir von Gottes Zorn befreit werden können. Gott musste seinen Zorn abladen, er konnte nicht einfach vergeben, weil Blut notwendig ist für Vergebung. Auch wenn dies eventuell eine Vereinfachung (oder sogar Karikatur) der Idee der Reformatoren ist, ist es doch eine Vorstellung, die weitverbreitet ist unter Christen vieler evangelikalen Gemeinden. Solch ein Gottesbild gleicht allen anderen Göttern der Antike. Sie alle haben Opfer verlangt, um besänftigt zu werden. Sie alle wurden leicht zornig und mussten besänftigt werden, damit sie ihrem Zorn nicht freien Lauf ließen. Aber ist eine solche Sichtweise von Gott wahr? Entspricht dieses Bild dem Gott, den Jesus uns offenbart hat? So wie Härle, finde ich es schwierig solch ein Gottesbild zu vertreten.
In der ganzen Bibel und besonders bei Jesus sehen wir, dass Gott vergeben kann, ohne Opfer, ohne vergoßenes Blut und ohne Strafe zu verhängen. Bereits das Alte Testament bezeugt diese Wahrheit in Psalm 103.
Psalm 103,8–10 (NGÜ): Barmherzig und gnädig ist der Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten, er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen.
Jesus hat immer wieder Sündern vergeben: dem Gelähmten (Markus 2,5), der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde (Johannes 8,1–11), Zachäus (Lukas 19,1–10) und der sündigen Frau (Lukas 7,47). Jesus vergab ihnen, ohne vorher ein Opfer zu verlangen oder sie zu bestrafen, damit gewisse Anforderungen der Gerechtigkeit erfüllt werden konnten.
Aber was ist mit Hebräer 9:22?
„Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung.“ (Hebr 9,22, NGÜ).
Die Frage ist: ist V. 22b, „ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung“, eine universal gültige Aussage oder nicht?
Viele Christen halten es für eine universal gültige Aussage, dass Vergebung ohne Blutvergießen unmöglich ist. Aber wenn wir den Vers im Kontext lesen, finden wir gute Gründe, die darauf hinweisen, dass dies keine allgemein gültige Aussage ist!
In Hebräer 10,4 steht eindeutig, dass das Blut von Tieren die Sünden nicht wegnehmen kann! Im gesamten Kapitel 10 geht es darum, dass Gott keine blutigen Opfer will, sondern dass er unseren Gehorsam wünscht. In Kapitel 10 heißt es dreimal, dass Jesus deutlich gemacht hat, dass Gott keine Opfer will! Die Aussage des Hebräerbriefs ist, dass Gott keine Blutopfer will, sondern unseren Gehorsam. Jesus hat das Opfersystem abgeschafft, weil es nur ein Zugeständnis von Gott an die Israeliten war, das Gott für eine begrenzte Zeit erlaubte. Bereits im Alten Testament finden sich viele Verse, die andeuten, dass das Opfersystem so eine Art Akkommodation Gottes war (1 Sam 15,22; Ps 40,7; 50,8–10; 51,18–19; Jer 7,21–24; Hos 6,6; Jes 1,10–13; Am 5,21–27; Jes 66,2–4).
Hebräer 9,22 bestätigt diese Lesart. V. 22a gibt den Kontext vor: „nach dem Gesetz“. In diesem Vers geht es um das mosaische Gesetz, den alten Bund. Der alte Bund basierte auf der Vorstellung, dass Blut zur Vergebung notwendig ist. Aber auch im alten Bund gab es Ausnahmen, weshalb es heißt, dass „fast alles durch Blut gereinigt wurde“. „Zum Beispiel konnte ein verarmter Israelit dem Priester ein Zehntel eines Epha (vier Pfund) Feinmehl als Sündopfer bringen, anstatt eines Lammes oder sogar anstatt zweier Turteltauben oder junger Tauben (Lev. 5,11). In Num 16,46 wurde die Gemeinde Israels nach der Vernichtung von Korach und seinen Gefährten mit Weihrauch gesühnt“ (Bruce 1990:226–227). Diese Ausnahmen zeigen bereits, dass V. 22b keine universal gültige Aussage sein kann.
Ellingworth bekräftigt, dass es sich nicht um eine allgemeingültige Aussage handelt, indem er kommentiert, dass V. 22b „keineswegs sein eigenes unqualifiziertes Urteil darstellt, sondern eine einfache Beobachtung dessen ist, was innerhalb der alten, gesetzlichen Dispensation geschah: ‚Unter dem Gesetz….‘ “ (1993:472).
Mein Ziel mit diesem Beitrag ist nicht zu sagen, dass die eine oder andere Seite der Diskussion Recht hat, sondern vielmehr aufzuzeigen, dass beide Seiten gute Argumente haben und es nicht so einfach und klar ist, wie es oft dargestellt wird.
Herr Vogel, ich danke Ihnen für Ihren konstruktiven Beitrag, hoffe dass meine Gedanken hilfreich waren und wünsche Ihnen Gottes Segen.
Manuel Becker
Bibliografie:
Ellingworth, P. (1993). The Epistle to the Hebrews: a commentary on the Greek text (p. 472). Grand Rapids, MI; Carlisle: W.B. Eerdmans; Paternoster Press.
Sehr geehrter Herr Becker,
auch ich möchte mich kurzfassen.
„Ist Blut (oder ein Opfer) nötig zur Vergebung von Schuld?“
Mit Härle kritisieren Sie erneut ein Gottesbild, das tatsächlich nur eine schlimme Karikatur der reformatorischen Sühnelehre ist. Wenn Gott verlangen würde, dass der Mensch selbst ein blutiges (Menschen-)Opfer bringt, das die Sünden wegnimmt und Vergebung für die Ewigkeit ermöglicht, dann wäre das ein Gottesbild, das auch ich nicht teilen könnte. Darin sind wir uns einig.
Aber Gott fordert dieses Opfer ja auch gar nicht VON UNS, sondern Er stellt es SELBST, wie ich bereits in meinem ersten Kommentar hervorgehoben habe! Er gibt es selbst, in unfassbarer Liebe, um Vergebung zu ermöglichen. Aber auch das wird von Härle, von den Tübingern und auch von Ihnen (?) abgelehnt.
Sie führen Stellen an, die beweisen sollen, dass Gott auch ohne vergossenes Blut vergibt. Die Nichterwähnung des Blutes an solchen Stellen liefert jedoch keinerlei Beweis dafür, dass ein stellvertretendes Sühnopfer unnötig sei. Natürlich hat der Psalmdichter David geopfert! (Nur dann, wenn man wie viele Theologen unserer Zeit die Opfervorschriften des Buches Levitikus erst in der spät- oder nachexilischen Zeit formuliert sehen würde, könnte man überlegen, ob die Nichterwähnung von Opfern hier eine besondere Aussagekraft hat. – Die heute in der Theologie vorherrschende Ablehnung der biblisch-reformatorischen Sühnelehre ist nicht ohne massive Sachkritik an AT und NT denkbar.)
Zu Recht schreiben Sie, dass Jesus in seinem Leben auf der Erde kein Opfer VON DEN MENSCHEN verlangt habe. Im Gegenteil, Er gab sich selbst als das einzige Opfer, auf dessen Grundlage Sünden für die Ewigkeit vergeben werden können, und zwar die Sünden der atl. Gläubigen, die Sünden der glaubenden Menschen, die mit Jesus auf der Erde lebten, und die Sünden aller Glaubenden nach dem Kreuz.
Aber was ist mit Hebräer 9,22?
Aufgrund des Kontextes halten Sie die Aussage „Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung“ nicht für allgemeingültig. Wenn man zum Kontext nur die Verse 19–21 zählen würde, müsste ich Ihnen zustimmen. Aber schon die Verse 18 und 22 zeigen, dass man den aussagefähigen Kontext nicht so willkürlich beschränken darf. Und der Gesamtkontext des Hebräerbriefes und speziell der Kontext der Kapitel 9 und 10, in denen das vollgültige Sühnopfer Jesu den „Schattenbildern“ des AT gegenübergestellt wird, beweisen die Allgemeingültigkeit. Die „Probe“ dafür kann mit Kap. 10,19 machen: Den Zugang zu Gott im himmlischen „Heiligtum“ (der Vergebung voraussetzt) haben wir nur „durch das Blut Jesu“.
Noch ein Hinweis zu den Opfern im AT. Die hat Gott tatsächlich VOM MENSCHEN gefordert, aber es waren keine Menschenopfer (wie sie der biblisch-reformatorischen Sühnelehre oft von der Kritik zu Unrecht vorgeworfen werden), es waren Tieropfer. Diese konnten „keine Sünden wegnehmen“, sie bewirkten für die Frommen des AT nur eine äußerliche Reinigung und Vergebung, so dass sie in der irdischen Volks- und Gottesdienstgemeinschaft bleiben konnten. Und sie erinnerten die Israeliten immer wieder an die Notwendigkeit eines kommenden Erlösers. Im Blick auf die Rechtfertigung und das ewige Leben war ein ganz anderes Sühnopfer nötig, das eine vollgültige Opfer, das Gott selbst gestellt hat, und auf das alle diese Opfer hinwiesen (vgl. Hebräer 10,12–14; Römer 3,25).
Vielen Dank, Herr Becker, für Ihr schnelle Antwort! Ich bitte Sie herzlich, über den Punkt nachzudenken, dass GOTT SELBST nach der biblisch-reformatorischen Sühnelehre das Sühnopfer gestellt hat. Das müsste den größten Teil der gedanklichen Schwierigkeit wegnehmen können. Was es nicht wegnimmt, ist … das Ärgernis des Kreuzes.
Mit freundlichem Gruß
Günter Vogel
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Herr Vogel.
Ihr Kommentar hat mir noch einmal besser geholfen Ihren Punkt besser verstehen zu können.
Ich denke Härle und ich behaupten nicht, dass Gott ein Opfer von den Menschen verlangt hat. Wir verstehen, dass Jesus das Opfer war, was nötig war für unsere Erlösung und dass Jesus sich selbst aus Liebe zum Vater und zu uns freiwillig geopfert hat. Ich denke der springende Punkt, um den es geht, ist die Frage, was genau der Tod Jesu bewirkt hat. Und da möchte ich Härle zustimmen, dass wir in der Bibel eine Vielzahl an Bildern finden, die versuchen, das Werk am Kreuz zu beschreiben und in Worte zu packen, dass es aber schwierig für uns Menschen bleibt, im Detail zu verstehen, wie genau das Kreuz funktioniert. So wie ich Härle verstehe, richtet er sich hauptsächlich dagegen, dass Gott das Opfer Jesus gebraucht hat, um uns vergeben zu können. Also die Idee, dass das Opfer Jesu nötig war, um Gott zu befähigen, etwas tun zu können, was er vorher nicht tun konnte. Härle erwähnt den Punkt, dass ein Opfer den Schuldpreis bezahlt und wenn eine Schuld bezahlt ist, dann ist es keine Vergebung mehr. Vergebung braucht kein Opfer. Gott kann jederzeit vergeben. Wogegen Härle sich wehrt, ist Gottes Möglichkeit zur Vergebung einzugrenzen und das (antike) Gottesbild eines zornigen Gottes, der besänftigt werden muss. Aber um diese Frage besser klären zu können, müsste man tiefer überlegen, was Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit usw. genau bedeuten und das würde etwas zu lange werden für ein Kommentar-Gespräch.
Aber ich denke, wir sind uns alle drei einig, dass Jesu Opfer am Kreuz nötig war, um uns zu erlösen. Gott selbst hat durch Jesus den Weg zur Versöhnung möglich gemacht. Das reformatorische Denken sagt, das Opfer war nötig, um Gott umzustimmen. Ich verstehe den Tod Jesu eher, als das Lösegeld (Mt 20,28), welches bezahlt werden musste, um uns freizukaufen aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Der Tod Jesu war also nötig, aber nicht, um Gott friedlich zu stimmen oder zu befähigen vergeben zu können. Ich verstehe das Kreuz also eher im Lichte des Christus Victor Motivs der Bibel, also Jesus als der Sieger über alle bösen Mächte. Der Messias wird immerhin in die Bibel eingeführt, als der, der der Schlange den Kopf zertritt und die bösen Mächte und das Böse bezwingt. Aber vermutlich gehören alle diese Motive zusammen und können nur gemeinsam ein wunderschönes Bild vom Erlösungswerk unseres Herren ergeben.
Ich denke, es gibt gute Argumente auf beiden Seiten. Aber wir sind uns alle einig, dass Jesu Tod nötig war und wir allein durch ihn errettet werden können, egal wie genau das jetzt funktioniert! 🙂
Mit freundlichen Grüßen
Manuel Becker
Danke, Herr Becker! Gut, dass sich der entscheidende Punkt immer klarer herausstellt. Es ist die Frage, ob Gott völlig voraussetzungslos vergibt oder ob seine Heiligkeit und Gerechtigkeit zuvor Sühnung erfordern.
Sie schreiben zutreffend, dass es eine Vielzahl von Bildern in der Bibel gibt, die das Erlösungswerk Jesu beschreiben. Aber wer bestreitet das denn? Das Problem ist vielmehr, dass viele Theologen das als (Schein-)Argument benutzen, um Sühnung durch das Blut Jesu als Voraussetzung für Gottes Vergebung auszuschließen, und dabei die diesbezüglichen Stellen weitgehend ignorieren.
Ich hatte zu Beginn auf das Passah hingewiesen („Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen.“). Der Herr selbst stellt eine Verbindung zum Passah als Typos her, wenn Er das Abendmahl anlässlich des Passahfestes einsetzt. Und 1. Korinther 5,7 bestätigt die typologische Bedeutung des Passahs. – Kann man das einfach IGNORIEREN, weil es noch viele andere Aspekte des Kreuzestodes Jesu gibt? Verbietet uns nicht die Gottesfurcht, so zu handeln?
Oder Jesaja 53,6. „Der HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld.“ Das NT sieht Jesaja 53 eindeutig als messianisch. Es geht also um stellvertretendes Leiden Jesu unter dem Strafgericht Gottes, damit dieses uns nicht treffen muss. Diesen Vers kann man verdrängen; aber durch Verdrängen beweist man nicht, dass der Inhalt nichtexistent sei. Es gibt Theologen, die völlig anerkennen müssen, dass dieser Vers tatsächlich das lehrt, was die Reformatoren gelehrt haben. Mehr noch, sie erkennen auch an, dass neutestamentliche Anführungen von Psalm 53 oder Anspielungen darauf in den Paulusbriefen anscheinend ebenfalls dasselbe lehren. Und doch rauben sie der Aussage dieses Verses ihre Autorität als Gotteswort. So z. B. der Tübinger Hofius mit massiver Sachkritik an AT und NT (Hofius, O., Das vierte Gottesknechtslied in den Briefen des NT, in: B. Janowski u.a. (Hrsg.), Der leidende Gottesknecht, Tübingen 1996, 107–127). Kurz mit meinen Worten skizziert: Jesaja 53 sei nicht von Jesaja, auch nicht von Deuterojesaja. Deuterojesaja habe die ersten drei Gottesknechtslieder geschrieben und das Thema besser verstanden. Jesaja 53 sei hingegen im Schülerkreis des Deuterojesaja entstanden, wo man das Thema nicht mehr so gut verstanden habe. Und Paulus habe lediglich Anspielungen aus der Gemeindetradition auf Jesaja 53 aufgegriffen. Diese Gemeindetradition habe das vielleicht ähnlich gehen, wie der Schülerkreis Deuterojesajas. Paulus selbst habe diese Aussagen in seine Briefe eingebaut, aber zugleich im Kontext deutlich gemacht, dass er selbst NICHT so denkt! – Ich weiß nicht, wie Härle mit Jesaja 53,6 umgeht – aber ohne massive Sachkritik an der Bibel wird man die Aussage dieses Verses nicht los!
Ein letzter biblischer Hinweis: Die Opfer des großen Sühnetages von 3. Mose 16 werden im Hebräerbrief als typologische Hinweise auf das Sühnungswerk Christi betrachtet. In den unterschiedlichen Opfern dieses Tages werden unterschiedliche Aspekte des Sühnungswerkes vorgebildet. (Darauf wollen wir ja achten!) Die markanteste Unterscheidung ist die zwischen den beiden Ziegenböcken: Der eine Bock ist ausdrücklich „für den HERRN”; sein Blut wird ins Heiligtum gebracht, um Sühnung vor Gott zu tun; der andere Bock ist „für ASASEL“, und dient zur „Abwendung“, zum Wegtragen der Sünden des Volkes (3. Mose 16,7.8).
In Ihrem Schlusswort klingt nur Letzteres an: die Errettung als Erlösung von unseren Sünden. Der Bedeutung des ersten Bockes kann die Theologie Härles in keiner Weise mehr Rechnung tragen!
Die theologische Auseinandersetzung darüber ist nicht neu. Vor allem seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird die biblisch-reformatorische Sühnelehre auf allen Kontinenten mit zahlreichen, oft unterschiedlichen Argumenten angegriffen, die in immer neuen Kombinationen präsentiert werden. Aber eine bibeltreue „Lösung” in Bezug auf die von mir angeführten Stellen ist nicht darunter. Die ständige Rekombination der kritischen Gene kann eben nicht zu einer Höherentwicklung führen. 😉 Wer leugnet, dass der unbekehrte Sünder unter dem Zorn Gottes steht (Johannes 3,36) betreibt Bibelkritik und sollte dazu stehen.
LOGOS bietet übrigens auch Darstellungen, die die Argumente der Kritiker sorgfältig untersuchen und entkräften. Zum Beispiel:
https://www.logos.com/product/188589/the-apostolic-preaching-of-the-cross-3rd-rev-ed
Im Deutschen fand ich nützliche Artikel im Sammelband aus dem Albrecht-Bengel-Haus: Gäckle, V. (Hg.), Warum das Kreuz? Die Frage nach der Bedeutung des Todes Jesu, Wuppertal 1998.
Und im Holländischen ist Herman Ridderbos nützlich: „Zijn wij op de verkeerde weg?”, Kampen 1972.
Das war jetzt ausführlich genug, um mein Schlussbeitrag hier zu sein. 😉 Das letzte Wort überlasse ich gern Ihnen.
Mit freundlichem Gruß
Günter Vogel
Herr Vogel, ich denke, Ihr letzter Kommentar ist ein hervorragender Abschluss für dieses Gespräch. Ich bedanke mich für den spannenden Austausch und den hilfreichen Verweis auf weiterführende Literatur.
Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen.
Mit freundlichen Grüßen
Manuel Becker