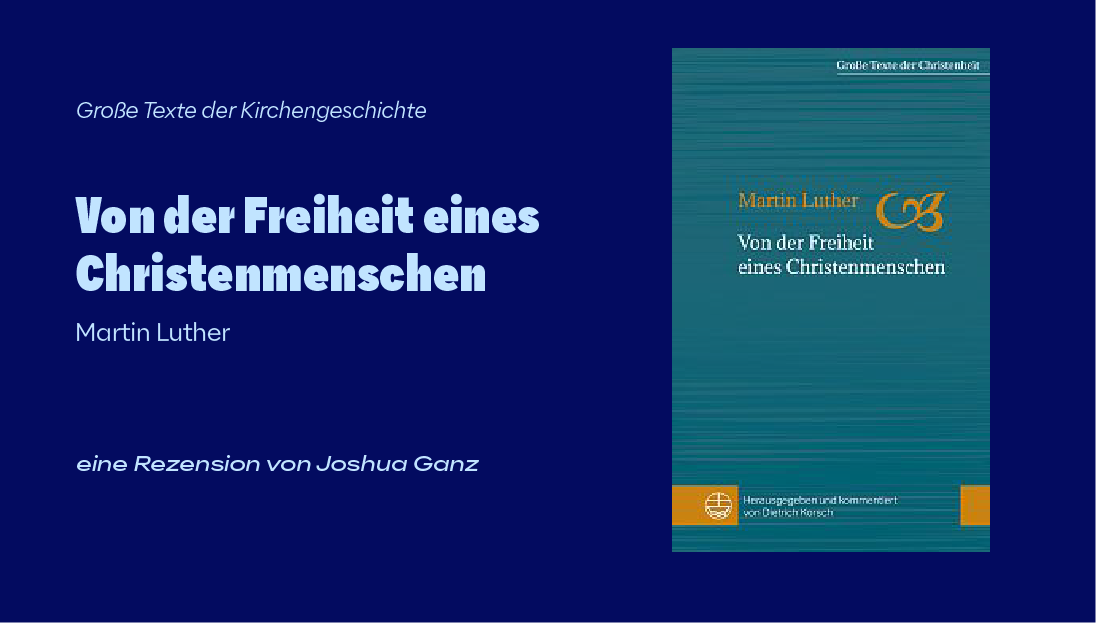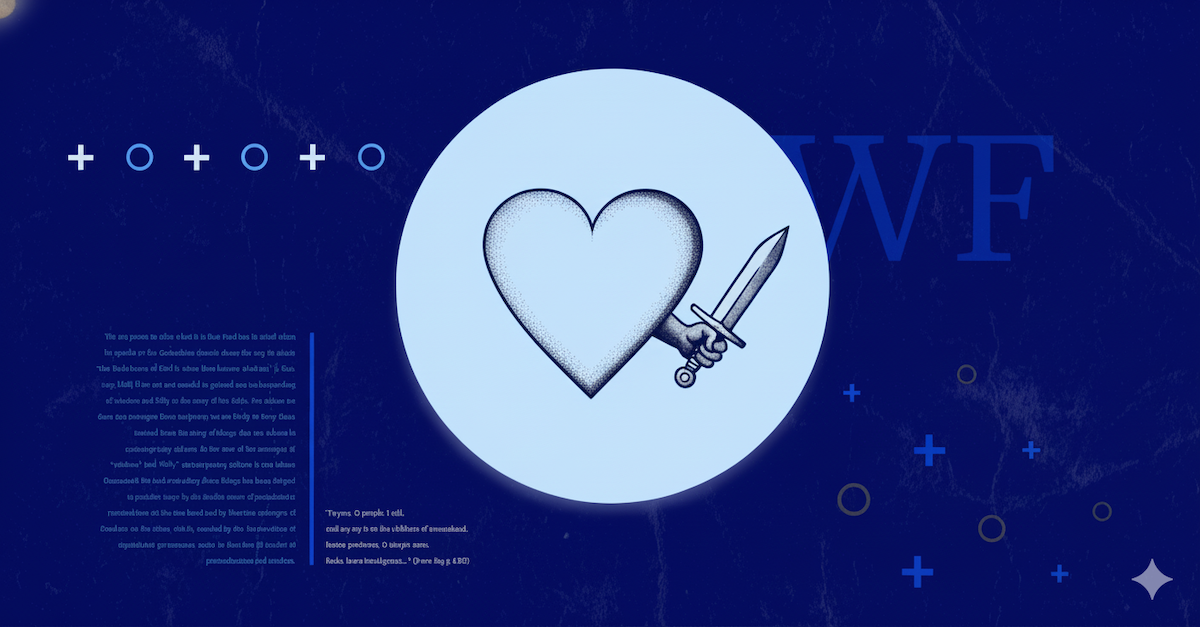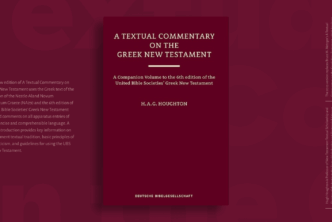Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ ist über 500 Jahre alt. Lohnt es sich, ein so altes Werk zu lesen? Kann es – nach heutigen Maßstäben – als seriöse Quelle in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet, also als „wissenschaftlich” bezeichnet werden – oder ist es längst überholt? Diese Frage werde ich Ihnen in den nächsten 7 Minuten beantworten.
Inhalt der Schrift
Der Inhalt klingt sehr modern: Es geht um die Freiheit eines Christenmenschen. Kann eine Schrift, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts verfasst wurde, noch in unsere Zeit sprechen? Auf jeden Fall muss man die historische Distanz wahrnehmen und sich bewusst sein, dass eine unmittelbare Anwendung kaum möglich ist. Die geistige und religiöse Situation Luthers ist nicht die unsere, und die Freiheitsvorstellungen seiner Zeit haben mit dem philosophisch-modernen Freiheitsbegriff wenig gemein. Eine gewinnbringende Lektüre der Schriften Luthers muss deshalb von einem genauen Verständnis des Textes in seinem historischen Kontext ausgehen, um von dort aus seine Bedeutung für heute zu erschließen.
Einen solchen Weg zu ermöglichen, ist die Absicht dieses Artikels. Die Pointe der Interpretation lautet: Das christliche Freiheitsverständnis eröffnet einen eigenen, freien Blick auf moderne Freiheitskonzepte, weil sich Christsein als Vollzug von Freiheit darstellt. Beide, Freiheit und Christsein, haben dieselbe Wurzel: Jesus Christus.
Inhalt der Schrift: Glaube vs. Werke
Der Glaube bildet das Herzstück des Christentums, eine Überzeugung, die im Neuen Testament immer wieder betont wird. Während der Reformation wurde intensiv darüber debattiert, was einen rettenden Glauben ausmacht. Insbesondere die Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Werken wurde leidenschaftlich diskutiert. Hierbei spielte Martin Luther eine entscheidende Rolle, denn er betonte, dass der Glaube allein für die Rechtfertigung vor Gott ausreicht.
In seinem Werk „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ sprach Luther über den „lebendigen Glauben“, der unweigerlich Früchte der Gerechtigkeit (Glaubenswerke, siehe Galaterbrief und Jakobusbrief) hervorbringt. Er betonte, dass die Rechtfertigung allein durch den Glauben geschieht, jedoch nicht durch einen isolierten Glauben, der keine Veränderung im Leben bewirkt. Diese Überzeugung von Luther führte zu intensiven theologischen Diskussionen, insbesondere mit der römisch-katholischen Kirche, die betonte, dass die Rechtfertigung durch Glauben und Werke erfolgt.
Protestantische Sichtweise
Für Luther und die protestantischen Reformatoren war Glaube gleich Rechtfertigung plus automatisch hinzukommende Werke. Die konstituierenden Elemente des rettenden Glaubens wurden von ihnen als notitia, assensus und fiducia identifiziert. „Notitia“ bezeichnet den Inhalt des Glaubens, „Assensus“ die Überzeugung in die Wahrheit dieses Inhalts, und „Fiducia“ das persönliche Vertrauen auf Christus als Retter.
Wenn man Martin Luther und sein Verständnis von Glauben und Werken nachvollziehen will, ist es wichtig, auch seine biografischen Einflüsse zu berücksichtigen. Luther selbst durchlebte eine tiefe geistliche Krise, in der er sich intensiv mit der Frage nach der eigenen Rechtfertigung vor Gott auseinandersetzte. Diese persönliche Erfahrung prägte seine theologischen Überzeugungen und führte zu einer radikalen Neubewertung der Bedeutung des Glaubens für das christliche Leben.
In seinem Traktat und anderen Schriften betonte Luther immer wieder die zentrale Rolle des persönlichen Vertrauens auf Christus als Retter. Er erkannte, dass dieser Glaube nicht allein auf intellektuellen Überzeugungen beruht, sondern eine tiefe persönliche Beziehung zu Christus einschließt. Diese Überzeugung Luthers hat nicht nur die Reformation geprägt, sondern auch die theologischen Diskussionen über Glaube und Werke bis heute beeinflusst.
Der Grund für Luthers Bekanntheit
Luther wollte nie bekannt, geschweige denn zitiert und gefeiert werden. Dass seine Schriften auch nach 500 Jahren noch gelesen werden, liegt also nicht an seiner Absicht. Es liegt auch nicht an seiner schriftstellerischen Begabung. Auch als Mensch wurde er nicht bekannt, weil er ein besonders auffälliger und glanzvoller Charakter war. Luthers Schriften werden bis heute gelesen, weil ihr Inhalt direkt aus der Bibel abgeleitet ist und von einer Wahrheit zeugt, die zeitlos ist. Seine Rede vom Evangelium, von der Rechtfertigung allein aus Glauben, ist in den Herzen vieler Gläubiger fest verankert und hochaktuell.
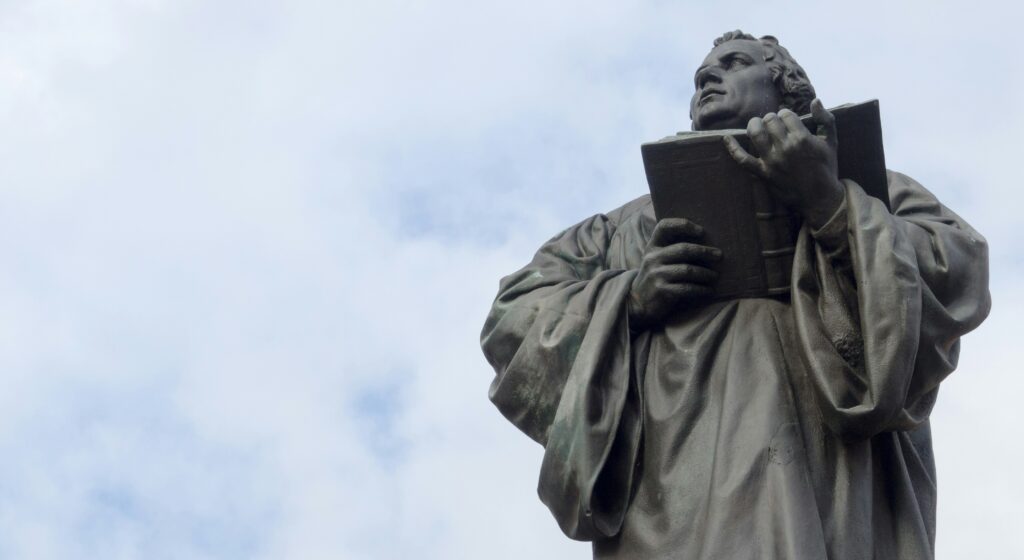
Enthaltene Schriften
Das vorliegende Werk enthält dreierlei: die frühneuhochdeutsche Wittenberger Erstausgabe Luthers, eine moderne, in unserem Schriftdeutsch gut verständliche Übersetzung von Dietrich Korsch und den Kommentar, den er dazu verfasst hat. In der Druckversion stehen Original und Übersetzung nebeneinander auf einer Seite, was den Vorteil hat, dass man sie schnell miteinander vergleichen kann. Für Sie als Leser ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, da heute kaum noch jemand diese veraltete Schrift lesen kann. Wer es dennoch wagen möchte, findet in der speziell für Logos bearbeiteten Fassung zuerst den Originaltext und dann die allgemein verständliche Version. Das Werk ist der erste Band der Reihe Große Texte der Christenheit. Diese Schrift Luthers ist neben seinen Thesen wohl die bekannteste und meistgelesene. Denn sie enthält das Herzstück von Luthers Theologie: die Rechtfertigung allein aus Glauben (sola fide). Wie kam Luther dazu, darüber zu schreiben?

Die Entstehung der Schrift
Luther war 34 Jahre alt, als er 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte, soweit zumindest die Legende. Mit dieser Aktion wandte er sich vor allem gegen den Ablasshandel. Nur drei Jahre später verhängte die katholische Reichskirche eine Bannandrohungsbulle über ihn. Doch Luther spornte dies nur zur Veröffentlichung einiger reformatorischen Gedanken an. Noch im selben Jahr verfasste er die Schriften Von den guten Werken, An den christlichen Adel deutscher Nation und nicht zuletzt Von der Freiheit eines Christenmenschen. In letzterer legte er seine Gedanken zum theologischen Begriff der Freiheit dar.
Was Freiheit bedeutete, drückte Luther auch noch auf andere Weise aus. Unter Berufung auf seine Funktion als Lehrer der christlichen Religion hatte er seinen Herkunftsnamen „Luder“ über die gräzisierte Variante „Eleutherius“ (der Freie) in „Luther“ geändert. Der Name „Luther“ drückt aus, dass das Evangelium mit der eigenen Person zu tun hat und diese durch die Beziehung zu Gott in die Freiheit führt. Luther hat also nicht nur einen Freiheitsbegriff entwickelt, sondern Freiheit als Wesensmerkmal christlichen Lebens dargestellt. Und er hat sie selbst auch ganz praktisch gelebt.
Gliederung der Schrift
Um Ihnen ein Überblick über den Inhalt zu geben, werde ich die kurze Schrift gliedern. Luther hat sein Anliegen bezüglich des Verhältnisses von Glauben und Taten in 30 Thesen verfasst.
- These 1–2 Einleitung: Christsein bedeutet frei sein und geknechtet sein durch Christus
- These 3–18 behandelt den inneren Menschen. Hier wird Luthers damals revolutionäres Schriftverständnis ersichtlich
- These 19–28 beinhaltet die Frage, was es mit den (Glaubens-)Werken auf sich hat und in welcher Relation diese zum rettenden Glauben stehen.
- These 29–30 dient dazu, seine Schrift zusammenzufassen und einige Hinweise für das praktische Leben als Christ zu geben.
Der Begleitkommentar zu „Von der Freiheit eines Christenmenschen“
Der Begleitkommentar zu dieser Ausgabe ist mit seinen drei Teilen sehr ausführlich. Der erste Teil behandelt sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte. Im zweiten Teil nimmt Korsch den historischen Faden auf und bettet Luthers Schrift in ihren Kontext ein. Der letzte und größte Teil umfasst Korschs Interpretation und seine Erklärungen zum Text.
Interpretation
Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ ist ein komplexer Text, der einer sorgfältigen Lektüre bedarf. Dietrich Korsch betont daher in seiner Interpretation in dieser Neuausgabe die Wichtigkeit, den Wortlaut genau zu beachten, einschließlich der rhetorischen Figuren, der Stilwechsel und der Bibelzitate, die wesentliche Bestandteile des Inhalts sind. Dies ist entscheidend, um den vollen Gehalt des Textes zu erfassen.
Luthers Gedanken können aber auch anders formuliert und im Kontext moderner Ideen kritisch gewürdigt und hinterfragt zu werden. Dies gilt auch für den Autor selbst, der auf diese Weise in einen Gedankendialog einbezogen wird.
Der Kommentar von Dietrich Korsch verbindet zwei Methoden: eine erklärende und eine konstruktiv-kritische. Die konstruktiv-kritische Analyse steht in der Tradition Luthers, der die Bibel als Wort Gottes verstanden und ihr damit eine hohe Autorität zuerkannt hat. Daher müssen sich die theologische Arbeit und das Urteil der Lesenden und Hörenden an den biblischen Texten orientieren. Auf diese Weise steht die Arbeit in der Tradition Luthers, der die Autorität nicht beim Autor, sondern im Text selbst sah.
Luther selbst hielt seine Schrift für wichtig. In einem Brief an Papst Leo X. betonte er, dass das Werk trotz seiner Kürze die ganze Summe des christlichen Lebens enthalte, wenn es richtig verstanden werde. Der Kommentar von Korsch soll helfen, diesen tieferen Sinn zu erschließen und die Bedeutung der Schrift für die heutige Zeit aufzuzeigen.
Fazit zu dieser Neuausgabe
Die Neuausgabe dieser bedeutenden Schrift des Reformators Martin Luther wirft wichtige Fragen auf, insbesondere die nach der Relevanz eines über 500 Jahre alten Textes für moderne Leser, vor allem aus protestantischen und evangelikalen Kreisen. Trotz des historischen Kontextes und der sprachlichen Hürden bietet die Schrift zeitlose Einsichten in das christliche Verständnis von Freiheit und Glauben. Zentral aus reformatorischer Perspektive ist die Einsicht, dass Glaube und Glaubenswerke unterschieden werden müssen.
Der Begleitkommentar betont die Wichtigkeit einer genauen Lektüre und bietet Interpretationsansätze, um Luthers Text sowohl kritisch zu hinterfragen als auch konstruktiv zu würdigen. Indem der Kommentar die Bibel als Maßstab und die theologische Arbeit als Dialog betrachtet, steht er in der Tradition Luthers.
Insgesamt ist „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ nicht nur ein historisches Dokument, sondern auch ein lebendiger Text, der weiterhin zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung einlädt, besonders für protestantische und evangelikale Leserinnen und Leser, die nach einem tieferen Verständnis der Grundlagen ihres Glaubens streben.
Wenn Ihnen die biblisch-theologische Betrachtung von der katholischen und protestantischen Sichtweise zum Thema Glaube vs. Werke in diesem Artikel zu kurz gekommen ist, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gerne kann ich in einem weiteren Beitrag diese Thematik tiefer entfalten.