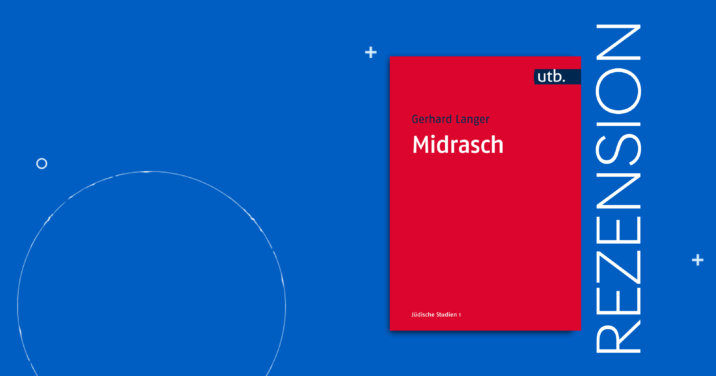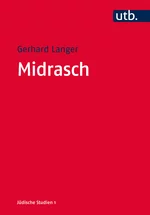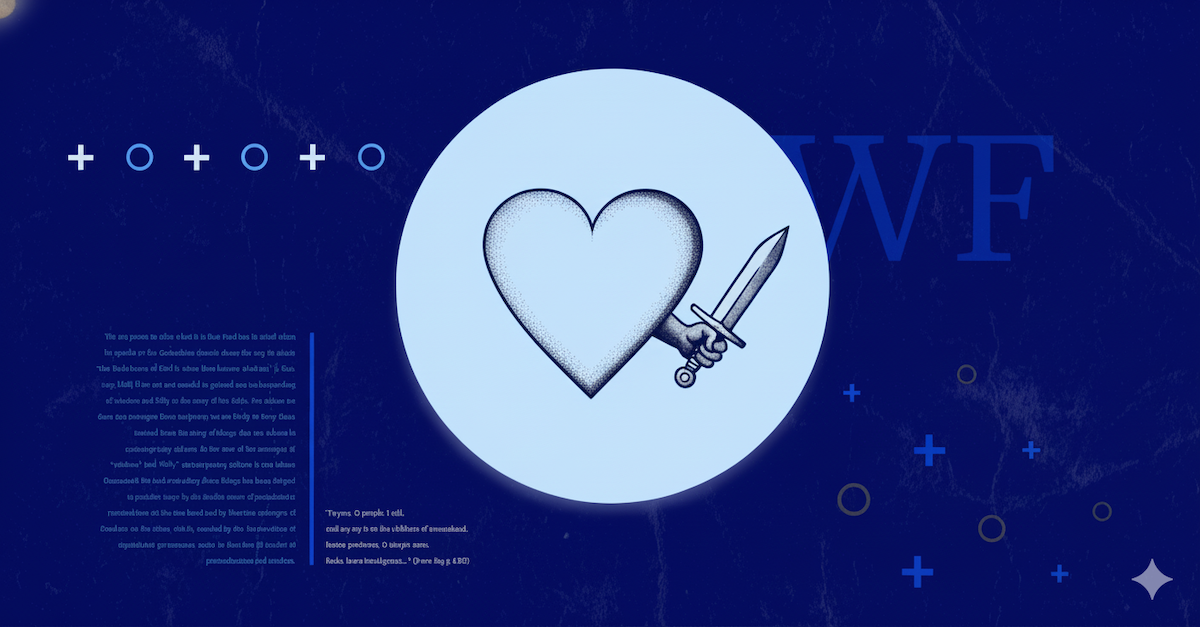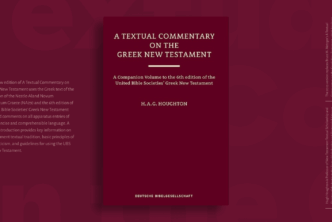Wenige Christen wissen, was Midrasch eigentlich ist – dabei eröffnet diese jüdische Auslegungstradition faszinierende neue Zugänge zur Bibel. Diese Rezension bietet Ihnen in nur 12 Minuten einen kompakten Einblick in Gerhard Langers Buch „Midrasch“ – und vermittelt einen verständlichen Überblick über das faszinierende Phänomen der jüdischen Schriftauslegung.
Inhalt
Das Phänomen Midrasch
Midrasch—Was hat ein jahrtausendealtes rabbinisches Auslegungsprinzip mit unserem heutigen Bibelverständnis zu tun?
Die Bibel gleicht einem tiefen Brunnen – und Midrasch ist die Kunst, schöpferisch und respektvoll in diesen Brunnen hinabzusteigen, um verborgene Bedeutungen ans Licht zu bringen. Diese jahrhundertealte jüdische Auslegungstradition lädt nicht dazu ein, den Text einfach nur zu erklären, sondern ihn zu befragen, mit ihm zu ringen und ihn in den Dialog mit der Gegenwart zu bringen.
Für viele Christinnen und Christen ist „Midrasch“ ein unbekanntes Terrain. Doch wer die Bibel liebt, wird hier auf ein Auslegungserbe stoßen, das zutiefst bereichernd ist – und neue Perspektiven auf altbekannte Texte eröffnet. Gerhard Langers Buch Midrasch macht diesen Schatz zugänglich. Es ist eine Einladung, die Bibel mit jüdischen Augen zu lesen – nicht, um die eigene Perspektive zu verlieren, sondern um sie zu vertiefen. Die Begegnung mit dem Midrasch lohnt sich – gerade auch für christliche Leserinnen und Leser.
Der Autor: Gerhard Langer
Der Autor, Gerhard Langer, ist Professor für Judaistik an der Universität Wien und trat die Nachfolge des renommierten Judaisten Günter Stemberger an, der bereits 1989 mit seiner Einführung in den Midrasch Maßstäbe setzte. Langer knüpft an diese Tradition an, führt sie jedoch mit aktuellem Forschungsstand, didaktischer Klarheit und einem besonderen Gespür für die Vermittlung jüdischer Auslegungstraditionen an ein breiteres Publikum weiter. Als Experte auf dem Gebiet der rabbinischen Literatur bringt er tiefes Fachwissen und jahrzehntelange Lehrtätigkeit in sein Werk ein.
Was ist das Ziel des Buches?
Im Mittelpunkt von Gerhard Langers Buch Midrasch steht die Frage, wie das Phänomen Midrasch in seiner ganzen Tiefe und Vielfalt zu verstehen ist – nicht nur als Textgattung, sondern als lebendige jüdische Auslegungstradition. Der Band ist der erste Teil der UTB-Lehrbuchreihe Jüdische Studien, herausgegeben von René Bloch, Alfred Bodenheimer, Frederek Musall und Mirijam Zadoff, und richtet sich nicht nur an Studierende der Judaistik und benachbarter Disziplinen, sondern an alle, die sich vertieft mit der jüdischen Traditionsliteratur beschäftigen möchten.
Langer verfolgt ein klares Ziel mit seinem Buch:
„Dieses Buch nähert sich dem Phänomen Midrasch mit der Absicht an, es nicht nur zu definieren, sondern in seinen unterschiedlichen Ausprägungen zu beschreiben, seine Hermeneutik zu illustrieren und Anleitungen für den Umgang mit ihm zu bieten.“
Tatsächlich gelingt es Langer, aus verschiedensten Perspektiven auf das Phänomen Midrasch zu blicken. Gleich zu Beginn stellt er klar, dass es nicht um eine detaillierte Vorstellung einzelner Midraschwerke geht, sondern um eine Einführung in das sachgerechte Lesen midraschscher Texte.
Dabei betont Langer realistisch, dass ein einziges Lehrbuch nicht ausreiche, um das komplexe Phänomen Midrasch vollständig zu erfassen. Vielmehr versteht sich sein Werk als eine Art kompaktes Kompendium oder Nachschlagewerk, das die gesamte Breite der Midraschforschung reflektiert. Besonders hervorzuheben ist, dass das Buch einen weiten historischen Bogen spannt: von den klassischen rabbinischen Midraschim über mittelalterliche Ausprägungen bis hin zu jiddischen und modernen Formen. So entsteht ein umfassender Überblick über die Entwicklung und Bedeutung dieser einzigartigen Auslegungstradition.
Inhalt des Buches
Das Buch gliedert sich in 14 durchdachte Kapitel, die Schritt für Schritt in das vielschichtige Phänomen Midrasch einführen. Der Aufbau folgt einer klaren didaktischen Linie und ermöglicht Leserinnen und Lesern sowohl den Einstieg in das Thema als auch die vertiefte Auseinandersetzung mit konkreten Fragestellungen.
Der erste Abschnitt bietet einen kompakten Überblick über die Forschungsgeschichte des Midrasch und bereitet das Feld für die weiterführenden Kapitel. Hier werden die verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven vorgestellt, aus denen der Midrasch betrachtet und erforscht werden kann. Im zweiten Kapitel steht die Frage im Zentrum, was Midrasch überhaupt ist – mit einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Begriff darasch/Midrasch und dem kulturellen und historischen Kontext seiner Entstehung.
Das dritte Kapitel führt in die hermeneutischen Grundlagen des Midrasch ein und legt damit das Fundament für das Verständnis der rabbinischen Auslegungstraditionen. Daran schließt sich ein vierter Abschnitt an, der die Ursprünge midraschischer Elemente bereits in vorrabbinischer Zeit und außerhalb der rabbinischen Literatur nachzeichnet.
Im fünften Teil geht es um die methodische Auslegung von Midraschtexten, gefolgt von zwei Kapiteln über spezifische methodische Schritte: die Formelemente des Midrasch (VI) und die Anwendung redaktionskritischer Perspektiven (VII). Die Kapitel VIII bis XII analysieren den Midrasch in verschiedenen thematischen Kontexten – als Exegese, im Bereich des Rechts (Halacha), der Erzähltradition (Haggada), der Liturgie und in der jüdischen Geschichtsschreibung.
Obwohl der Fokus des Buches auf der rabbinischen Epoche (ca. 70–1000 n. Chr.) liegt, widmet Langer auch dem Weiterleben midraschischer Elemente vom Mittelalter bis in die Moderne einen eigenen Abschnitt (XIII). Hier kommen mittelalterliche Kommentare, jiddische Bearbeitungen, moderne Neuformulierungen und anthologische Sammlungen in den Blick.
Den Abschluss bildet eine Faktensammlung zu den wichtigsten Midraschwerken (XIV), die einen schnellen Überblick über zentrale Texte und deren Inhalte bietet. Jedem Kapitel (ab II) ist ein kompaktes Literaturverzeichnis vorangestellt, das die Orientierung erleichtert, während eine ausführliche Gesamtbibliografie am Ende zur weiteren Vertiefung einlädt. So ist das Buch zugleich Einführung, Nachschlagewerk und Wegweiser in die faszinierende Welt der Midrasch.
Einblicke in das Buch
Was ist Midrasch?
Diese Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten – und genau darin liegt seine Faszination. Midrasch ist weit mehr als bloße Bibelauslegung. Er ist eine traditionsreiche, kreative und tief verwurzelte Form jüdischer Schriftauslegung, die das Ziel verfolgt, die Kluft zwischen dem biblischen Text und der Lebenswelt der Auslegenden zu überbrücken. Gerhard Langer, der sich in seinem Buch auf die Definition von Gary Porton stützt, beschreibt Midrasch als ein literarisches Genre, das sich auf einen religiös autoritativen Text bezieht, ihn entweder wörtlich zitiert oder klar erkennbar anspielt – und ihn anschließend auslegt. Dabei wird die Bibel nicht als toter Text, sondern als vollkommene, widerspruchsfreie und klare Schrift verstanden, die dennoch Lücken aufweist, die es auszufüllen gilt (S.32).
Midrasch ist keine Erfindung der rabbinischen Zeit, sondern setzt eine bereits innerbiblisch beginnende Tradition der Reflexion und Interpretation fort. Er versteht sich als ein intertextuelles, dialogisches Ringen mit dem Text, das Unklarheiten, Lücken und offene Fragen – sogenannte gaps – aufgreift, um die biblische Vergangenheit für die Gegenwart fruchtbar zu machen (S.16).
Kreativität, Dialog und Relevanz
Der Begriff darasch, von dem „Midrasch“ abgeleitet ist, bedeutet ursprünglich „fragen“ oder „nachforschen“ – im biblischen Kontext etwa das Befragen Gottes durch Propheten. In der rabbinischen Zeit entwickelt er sich hin zu einer hermeneutischen Haltung, in der das Studium und die kreative Auseinandersetzung mit der Schrift im Vordergrund stehen – insbesondere im Lehrhaus, dem zentralen Ort des Lernens (S.36).
Neuere Forschungen (z. B. von Heinemann, Boyarin oder Levinson) betonen, dass Midrasch nicht nur Auslegung ist, sondern auch Vergegenwärtigung und Weiterdenken der Schrift. Er ist ein Dialog mit dem Text, in dem Autorität und Freiheit nebeneinanderstehen. Wichtig ist: Midrasch ist nicht willkürlich – die Auslegung folgt bestimmten hermeneutischen Regeln, bezieht sich auf den ursprünglichen Text und bleibt offen für Mehrdeutigkeiten. So wird die Bibel zu einem immer neu befragbaren Raum, in dem Gottes Wort lebendig bleibt – auch über Jahrhunderte hinweg (S.36).
Midrasch: ein Beispiel aus dem Alten Testament-Kontext
Ein besonders spannendes Beispiel rabbinischer Midrasch-Interpretation findet sich in der Auslegung des biblischen Gebots „Auge um Auge“ (Lev 24,20). Während viele Christen diesen Vers als ein Beispiel für brutale Vergeltung verstehen, zeigt der Midrasch deutlich, dass die Rabbinen diesen Vers nicht wörtlich, sondern hermeneutisch durchdacht interpretierten – als Anordnung zur finanziellen Entschädigung (S.203–204).
So argumentiert Rabbi Jischmael anhand von Lev 24,21, dass der Text die Schädigung eines Menschen mit der eines Tieres vergleicht. Da ein verletztes Tier durch Geld ersetzt wird, müsse das auch für Menschen gelten. Auch Rabbi Isaak deutet in diese Richtung: In Ex 21,30 erlaubt das Gesetz sogar bei einem Tötungsdelikt die Zahlung eines Lösegelds. Wenn das bei solch einem schweren Fall möglich ist, dann erst recht bei weniger gravierenden körperlichen Verletzungen.
Rabbi Eliezer wiederum analysiert die Struktur der Bibelverse und zeigt anhand der typischen rabbinischen Auslegungstechnik von Allgemein- und Einzelaussagen, dass es auch bei absichtlich zugefügten Verletzungen nicht um wörtliche Rache geht. Stattdessen, so seine Schlussfolgerung, soll der Täter eine Geldstrafe zahlen – selbst bei bleibenden Schäden an zentralen Körperteilen.
Diese Midrasch-Auslegung verdeutlicht auf eindrucksvolle Weise, dass die Rabbinen nicht blind am Wortsinn festhielten, sondern mit großem Respekt vor dem Text und ethischer Verantwortung lasen.
Midrasch im Neuen Testament
Dass das Neue Testament stark in der jüdischen Auslegungstradition verwurzelt ist, zeigt sich unter anderem daran, wie oft seine Autoren midraschartig mit den Texten des Alten Testaments umgehen. Jesus, Paulus und andere neutestamentliche Autoren standen ganz selbstverständlich in der Tradition des rabbinischen Denkens.
Die Geburts- und Passionsgeschichte
Ein besonders eindrückliches Beispiel für midraschartige Auslegung im Neuen Testament ist die Art und Weise, wie das Leben Jesu mit alttestamentlichen Texten verwoben wird. Bereits die Geburtsgeschichte Jesu ist durchzogen von Bezügen zur hebräischen Bibel: der Stern von Bethlehem erinnert an den messianischen Stern aus Numeri 24,17, die Flucht nach Ägypten und der Kindermord spiegeln Motive aus der Exodusgeschichte wider. Die Rückkehr der Familie aus Ägypten ruft Exodus 4 in Erinnerung, wo Mose nach Midian zurückkehrt. Auch die Darstellung Jesu als „neuer Mose“ – etwa in der Bergpredigt – ist ein typisches Beispiel für Midrasch, der durch kreative Neuverknüpfung alter Texte neue Bedeutungen erschließt (S.106).
Besonders die Passionsgeschichte ist stark geprägt von prophetischen und poetischen Bezügen, etwa zu Jesaja oder den Psalmen. Der Judaist Jon Levenson beschreibt daher treffend, dass ein großer Teil der frühchristlichen Christologie als „midraschische Rekombination“ biblischer Motive verstanden werden kann – insbesondere rund um die Figuren Isaak, den leidenden Gottesknecht und den Sohn Davids. Diese Art der Auslegung zeigt: Das Neue Testament ist tief im jüdischen Denken verwurzelt und verwendet Midrasch, um Jesus im Licht der Schrift zu deuten (S.106).
Weitere Beispiele
Ein weiteres Beispiel ist Matthäus 2,15: „Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“. Dieser Vers ist ein Zitat aus Hosea 11,1, wo ursprünglich das Volk Israel gemeint ist. Matthäus aber bezieht ihn auf das Kind Jesus. Damit wird der ursprünglich abgeschlossene Text neu gedeutet – ein klassisches Beispiel für typologische Auslegung, wie sie auch im Midrasch zu finden ist.
Auch Paulus verwendet häufig midraschartige Argumentationen. In 1. Korinther 10,1–4 deutet er den Wasser spendenden Felsen aus der Wüstenwanderung Israels allegorisch: Der Fels war Christus. Hier wird ein historischer Bericht zu einem Bild für geistliche Realität – ganz im Stil haggadischer Midraschim. Auch das „geistliche Getränk“ ist ein bildhaftes, auslegendes Lesen. Noch deutlicher wird es in Galater 4,21–31, wo Paulus die Geschichte von Hagar und Sara explizit „bildlich“ (ἀλληγορούμενα) deutet: Hagar steht für das irdische Jerusalem und die Knechtschaft, Sara für das himmlische Jerusalem und die Freiheit – eine tiefgreifende Umdeutung mit theologischer Schlagkraft.
Auch Petrus nutzt diese Art der Auslegung in Apostelgeschichte 2,16–21. Das Pfingstwunder deutet er mit einem Zitat aus Joel – obwohl dieses ursprünglich einen anderen Kontext hatte. Doch durch die aktuelle Anwendung wird die Schrift neu lebendig: Ein Prinzip, das auch im Midrasch zentral ist. Und schließlich findet sich in Hebräer Kapitel 7 eine hochkomplexe, typologisch-midrashartige Theologie, die Melchisedek als Vorbild Christi deutet.
Diese Beispiele zeigen eindrücklich: Die neutestamentlichen Autoren haben die Schrift nicht nur zitiert – sie haben sie weitergedacht, vertieft und auf ihre Gegenwart angewandt. Wer das Neue Testament besser verstehen will, kann daher viel gewinnen, wenn er es auch einmal mit der Brille des Midrasch liest.
Mein Fazit
Gegen Ende der Lektüre bleibt ein positiver Gesamteindruck. Besonders hervorzuheben ist, dass der Autor nicht versucht, eine bestimmte Sichtweise auf den Midrasch durchzusetzen. Stattdessen eröffnet er dem Leser ein breites Spektrum an Perspektiven und macht deutlich: Midrasch ist ein komplexes Phänomen, das sich jeder simplifizierenden Darstellung entzieht. Diese ehrliche intellektuelle Zurückhaltung ist wohltuend und erhöht den Wert des Buches als zuverlässige Einführung.
Die klare Struktur des Werks trägt entscheidend zur Lesbarkeit bei. Jedes Kapitel behandelt sein Thema in angemessener Tiefe. Besonders hilfreich sind die kurzen Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels, die das Gelesene noch einmal ordnen und den roten Faden erkennbar machen. Zahlreiche Beispieltexte veranschaulichen die behandelten Inhalte, was den theoretischen Erklärungen eine greifbare Dimension verleiht.
Hervorzuheben ist auch Kapitel XIV, mit Fakten zu den wichtigsten Midraschim – ein äußerst nützliches Nachschlagewerk. Die Anhänge mit Abkürzungsverzeichnis und Transkriptionstabelle erweisen sich als besonders hilfreich und bieten eine wertvolle Orientierungshilfe beim Lesen und Verstehen der Fachtexte. Die durchgängig erwähnte weiterführende Literatur ermöglicht es, bei Interesse gezielt tiefer in einzelne Themen einzusteigen.
Kurz gesagt: Das Buch erfüllt den Anspruch eines Lehrbuchs. Es ist informativ, gut durchdacht und hilfreich für alle, die sich für das Thema interessieren oder sich im Rahmen ihres Studiums mit Midrasch beschäftigen.
Eine kleine Einschränkung muss dennoch genannt werden: Für Laien ist das Buch nur bedingt geeignet. Es ist in einer sehr akademischen Sprache verfasst und erfordert ein gewisses Maß an Vorwissen und terminologischer Vertrautheit. Wer sich ohne Vorkenntnisse an das Thema heranwagen möchte, könnte mit der Dichte und Fachlichkeit des Textes überfordert sein.
Was Christen heute vom Midrasch lernen können
Was mir im Buch etwas gefehlt hat, was die midraschartige Herangehensweise für unseren heutigen Umgang mit der Bibel bedeuten könnte. Diese Brücke zur gegenwärtigen Bibelauslegung wäre eine spannende Ergänzung gewesen, denn ich denke, Christen können vom Midrasch viel darüber lernen, wie ein lebendiger, schöpferischer und zugleich ehrfürchtiger Umgang mit der Bibel aussehen kann. Denn die Bibel ist ein Buch aus jüdischer Hand – verfasst von jüdischen Autoren in einem jüdischen kulturellen Kontext. Es ist daher nicht nur legitim, sondern notwendig und bereichernd, sie mit jüdischen Augen und Auslegungswerkzeugen zu lesen.
Midrasch zeigt, dass die Bedeutung eines biblischen Textes nicht auf seinen wörtlichen Gehalt begrenzt ist. Vielmehr eröffnet sich durch allegorische, typologische oder dialogische Zugänge eine tiefere Wahrheit – oft eine, die dem ursprünglichen Text nicht widerspricht, sondern ihn weiterführt und in neue Kontexte hineinträgt. Die Rabbinen nahmen sich dabei große Freiheit in der Auslegung, achteten jedoch stets darauf, dass ihre Deutungen in den größeren Zusammenhang der Schrift passten. Dies muss beachtet werden, um Willkür in der Auslegung zu vermeiden.
Besonders inspirierend ist die Haltung, dass die Bibel nicht nur ein historisches Dokument ist, sondern ein lebendiges Wort, das in jeder Generation neu gehört und verstanden werden will. Midrasch lädt ein, die Bibel als Gesprächspartner zu sehen – als Text, mit dem wir im Dialog stehen dürfen, um herauszufinden, was Gottes Wort heute in unserer Welt zu sagen hat. Das ist kein willkürliches Spiel mit dem Text, sondern ein ehrlicher Versuch, Gott im Hier und Jetzt zu begegnen – mit offenen Fragen, aber auch mit dem Vertrauen, dass sein Geist in der Auslegung gegenwärtig ist.
Die Logos-Edition
Besonders hilfreich ist die Logos-Edition des Buches. Da das Werk mit zahlreichen Abkürzungen und viel fachlichem Vokabular arbeitet, war es äußerst praktisch, dass Logos beim Überfahren eines Begriffs mit der Maus sofort die Bedeutung der Abkürzung anzeigt. Ein Doppelklick auf ein unbekanntes Wort öffnet direkt eine Definition – eine enorme Erleichterung beim Lesen. Zudem sind viele der zitierten Midraschbeispiele mit den entsprechenden Ressourcen in meiner Logos-Bibliothek verlinkt, sodass ich die Stellen im Originalkontext nachlesen konnte. Für ein so akademisch anspruchsvolles Werk ist die Logos-Edition ein echter Gewinn.
Als Einzelwerk oder als Set
Das Buch kann bei Logos als Einzelwerk oder im Set erworben werden.
Im Set:
Stöbern Sie gerne weiter – Logos bietet noch viele weitere Bände der ausgezeichneten UTB-Reihe an, die sich ebenfalls zu entdecken lohnen.