Leid! Wir sind alle damit konfrontiert. Warum lässt ein guter Gott all das Leid zu? Die Theodizee-Frage ist eines der schwersten Themen in der Theologie. Verschaffen Sie sich in diesem Artikel einen Überblick über fünf verschiedene Ansätze zur Theodizee-Frage und vertiefen Sie gleichzeitig Ihr Verständnis zu diesem wichtigen Thema.
Lesezeit: 20 Minuten
Hinweis: Es ist unmöglich, ein solch komplexes Thema in der Kürze eines Blogartikels gründlich genug zu untersuchen. Viele Aspekte kommen zu kurz, bitte verzeihen Sie das. Dieser Blog soll einen Überblick verschaffen und dazu inspirieren, das Thema neu zu studieren.
Inhalt
- Warum lässt Gott Leid zu? Die Theodizee-Frage erklärt.
- Das Leid ernst nehmen und nicht verniedlichen
- Verschiedene Perspektiven auf das Leid
- Ansatz 1: Die klassische Antwort auf das Leid
- Ansatz 2: Der molinistische Ansatz
- Ansatz 3: Der offen theistische Ansatz
- Ansatz 4: Der Ansatz der essenziellen Kenosis
- Ansatz 5: Der skeptisch-theistische Ansatz
- Fazit
- Bibliografie
Warum lässt Gott Leid zu? Die Theodizee-Frage erklärt.
„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt.”
(Forrest Gump)
Wir alle wünschen uns ein gesegnetes Leben. Niemand will leiden, krank sein oder Eheprobleme haben. Aber die Realität entspricht oft doch eher einer Schachtel Pralinen. Das Leben ist gefüllt mit Momenten voller tiefer Freude, aber auch mit schmerzlichen Tälern, die fast nicht auszuhalten sind. Niemand bleibt von Leiderfahrungen verschont. Durch die Nachrichten kommt die Not der gesamten Welt in unser Wohnzimmer hinein. Naturkatastrophen, Menschenhandel, Kindesmissbrauch, Pandemien, Krieg, Armut—die Liste ist beinahe endlos.
Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise mit Nöten und Schicksalsschlägen konfrontiert. Deshalb entsteht natürlich immer wieder die Frage, warum ein guter Gott so viel Leid zulässt. Diese Frage wird oft als die Theodizee-Frage bezeichnet. Sie befasst sich mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen der Existenz eines allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gottes einerseits und dem Vorhandensein von Leid, Schmerz und Ungerechtigkeit in der Welt andererseits.
Die scheinbare Paradoxie liegt darin, dass ein allgütiger Gott es nicht wünschen würde, dass seine Schöpfung leidet, und seine Allmacht das Leiden mühelos verhindern könnte. Leid und Unrecht existieren jedoch. Daher stellt sich die Frage, ob entweder Gottes Allmacht, seine Allgüte oder gar seine Existenz angezweifelt werden müssen. Dieses Dilemma lädt dazu ein, den Charakter Gottes, die Dynamik der Schöpfung und die Komplexität des menschlichen Lebens auf tiefgreifende Weise neu zu durchdenken.
Die Theodizee-Frage begegnet mir bei evangelistischen Gesprächen in Deutschland am häufigsten. Sie ist eine der wichtigsten und zugleich schwersten Fragen. Sie rüttelt an den Grundlagen des Glaubens. Viele Menschen haben sich bereits von Gott abgewendet, weil sie im Angesicht unfassbaren Leids keine befriedigende Antwort auf dieses Dilemma gefunden haben. Unsere Reaktion auf dieses Problem zeigt sehr viel über unseren Glauben und unser Gottesbild. Sie prägt unser Weltbild und unser Verständnis davon, wie die Welt funktioniert.
Das Leid ernst nehmen und nicht verniedlichen
Die Notwendigkeit, eine weise Antwort auf die Theodizee-Frage zu finden, kann nicht überbetont werden. Auf der Suche nach einer Antwort müssen wir das extreme Leid in der Welt berücksichtigen und dürfen es nicht herunterspielen. Wir müssen diese Frage im Licht der schwersten Fälle beantworten, die keinerlei Happy End haben! Und wir benötigen eine Antwort, die wir auch einer Person im allertiefsten Leid sagen können.
Ein Beispiel:
Ein zehnjähriges Mädchen wird von ihren Eltern für 100 € an Menschenhändler verkauft und muss von da an als Kinderprostituierte ihren Körper jede Nacht an unzählige Freier verkaufen. Mit Gewalt, Drogen und Alkohol wird sie gefügig gemacht. Glück kennt sie nicht. Ihr Leben ist eine Tortur von Leid und Grausamkeit. Ihr Körper wird über die Jahre immer schwächer und sie stirbt mit 20 Jahren an den Folgen einer Krankheit, die sie sich bei einem Freier eingefangen hat.
Das Beispiel wirkt extrem, ist aber tatsächlich kein Einzelfall und soll nur stellvertretend für unzählige Situationen stehen, in denen Menschen wirklich tiefes Leid erleben. Was kann man einem Menschen sagen, der von größter Not betroffen ist?
Verschiedene Perspektiven auf das Leid
Die Theodizee-Frage ist eine der zentralen theologischen Fragen, die die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch bewegt hat. Sie durchdringt alle Facetten des Lebens und konfrontiert uns mit unseren eigenen Unsicherheiten, Ängsten und Kämpfen, wenn wir Schmerz, Verlust und Ungerechtigkeit erfahren. Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist nicht einfach. In der Bibel versucht es das Buch Hiob. Im Lauf der Geschichte haben viele Theologen weitere verschiedene Perspektiven und Erklärungsansätze zum Thema Leid entwickelt.
Je nachdem, wie unsere Antwort ausfällt, können wir Trost spenden und Hoffnung geben. Doch manchmal laden wir Personen, die bereits leiden und mit dieser Frage ringen, nur noch weiteres unnötiges Leid auf, wodurch ihre Last nur noch schwerer wird. Viele theoretische Antworten sind oft kalt und herzlos. Mit oberflächlichen Parolen können wir den christlichen Glauben zu einem Witz und damit unglaubwürdig machen.
In diesem Artikel stelle ich fünf Ansätze vor, die versuchen, eine Antwort auf die so wichtige Theodizee-Frage zu finden. Natürlich gibt es viele weitere Perspektiven, aber diese fünf decken die gängigsten von ihnen ab. Ich orientiere mich für diesen Artikel an dem Buch „God and the Problem of Evil: Five Views“ aus der „Spectrum Multiview“-Buchreihe. Diese versucht, unterschiedliche theologische Sichtweisen zu verschiedenen Themen miteinander ins Gespräch zu bringen.
Ansatz 1: Die klassische Antwort auf das Leid
Kurzfassung
Die klassische Antwort auf das Problem des Bösen lautet, dass kein Böses geschieht, wenn Gott es nicht zulässt, und dass Gott einen guten Grund hat, alles Böse zuzulassen, und zwar im Sinne eines höheren Nutzens, zu dessen Verwirklichung er das Böse gebraucht.
(Meister & Dew 2017:14)
Diese Antwort auf die Theodizee-Frage geht insbesondere auf die Theologie von Augustinus von Hippo zurück.
Die Natur des Bösen
Augustinus betrachtete alles Böse als eine Korruption des Guten. Für den Kirchenvater war „Korruption keine Form des Seins, sondern immer ein Versagen, etwas zu sein“ (Meister & Dew 2017:15). Das Böse ist nicht das Gegenteil des Guten, sondern dessen Unterdrückung oder Verdrängung. Das Böse ist nicht etwas Reales an sich, sondern das, was geschieht, wenn das von Gott geschaffene und gewollte Gute verdrängt und entstellt wird. Dies ist vergleichbar mit einem Schatten, der aus einem Mangel an Licht entsteht. Dies wird betont, um argumentieren zu können, dass Gott eine gute Welt geschaffen hat und nicht das Böse erschaffen hat, da es ja keine Realität in sich ist (Meister & Dew 2017:17).
Verdrehte Liebe als Ursprung des Leides
Augustinus argumentiert, dass wir geschaffen sind, um Gott zu lieben. Das Wichtigste ist, Gott mehr als alles andere zu lieben. Der Ursprung von allem Bösen ist, wenn wir Dinge oder Menschen mehr lieben als Gott.
In der Theologie des Augustinus ist alles moralisch Böse eine Art von Liebe. Es ist eine gestörte und deformierte, in die falsche Richtung gedrehte Liebe. Der Ursprung des Bösen ist die Liebe zu niederen Dingen anstelle von höheren Dingen.
(Meister & Dew 2017:23)
Wir sind geschaffen, um Gott zu lieben und seine Liebe an andere Menschen weiterzugeben. Stattdessen lieben wir viel zu oft Dinge, vergessen Gott und benutzen Menschen für unsere eigenen Zwecke. Diese falsche Art von Liebe erschafft allerlei Leid und Böses.
Diese verdrehte Liebe führt zu Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg sowie zum Missbrauch der Güter der Schöpfung und damit zu allerlei Chaos in der natürlichen Welt. Die ganze Schöpfung ist dem Bösen und der Vergänglichkeit unterworfen, weil der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, statt Weisheit und Gerechtigkeit Chaos in die Welt brachte.
(Meister & Dew 2017:26)
Zwei Kernprinzipien
Am wichtigsten ist für die klassische Sichtweise das Prinzip des größeren Guten. Dabei handelt es sich um die zweifache Lehre, dass (1) kein Übel ohne Gottes Erlaubnis geschieht und (2) Gott immer einen guten Grund für die Erlaubnis von Bösem hat, denn er nutzt jedes Übel, um ein höheres Gut zu erreichen.
(Meister & Dew 2017:26)
Diese Sichtweise vertritt den Standpunkt, dass Gott im Prinzip alles Schlimme verhindern könnte. Er hat sich jedoch dafür entschieden, es trotzdem zuzulassen. Der Grund dafür ist, dass er in seiner Weisheit weiß, wie er gerade aus diesen Übeln ein größeres Gut hervorbringen kann.
Pro
- Gibt Menschen Hoffnung, dass Gott einen guten Plan für jeden Menschen hat und Gutes aus Bösem entstehen lassen kann. So wie Hiob erleben wir oft Leid, ohne den Grund dafür zu kennen. Doch am Ende wird Gott ein Happy End für alle Gläubigen bewirken.
- Passt gut zu Bibelstellen, die davon sprechen, dass Gott alles vorherbestimmt hat und jedes Detail dieser Welt kontrolliert.
Kontra
- Im Angesicht des enormen Bösen, welches weltweit geschieht, fällt es den meisten Menschen schwer zu sehen, wie Gott daraus etwas Gutes entstehen lassen kann. Viel Böses scheint nichts Gutes hervorzubringen, sondern allein unaussprechliches Leid.
- Gott erlaubt alles Böse und wird dadurch von Menschen, die von schwerem Leid betroffen sind, oft als mitschuldig angesehen.
- Der Mensch hat keinen echten freien Willen, denn Gott dirigiert jedes Detail dieser Welt.
Ansatz 2: Der molinistische Ansatz
Mittleres Wissen
Dieser Ansatz basiert auf den Überlegungen des jesuitischen Philosophen, Theologen und Rechtstheoretikers Luis de Molina (1535–1600). Er war einer der einflussreichsten und kontroversesten Denker des 16. Jahrhunderts. Er versuchte, den freien Willen des Menschen mit der Vorherbestimmung durch Gott und seiner Allwissenheit in Einklang zu bringen. Molina entwickelte die Idee des mittleren Wissens. Ich will versuchen, diese kurz zu erklären.
Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Spiel und müssen dabei Entscheidungen treffen. Mittleres Wissen bedeutet zu wissen, was Sie und andere in verschiedenen Situationen tun würden, noch bevor diese tatsächlich eintreten.
Die molinistische Sichtweise ist also eine Art, über Gottes Wissen und seinen Umgang damit nachzudenken. Sie besagt, dass Gott alles weiß – nicht nur, was passieren wird, sondern auch, was passiert wäre, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Molinisten glauben, dass Gott dieses mittlere Wissen nutzt, um die bestmögliche Welt zu erschaffen, sie zu steuern und zu gestalten. Dabei berücksichtigt er jedoch alle Entscheidungen, die die Menschen treffen würden.
Die Kernidee
Molina glaubte, dass Gott dem Menschen echte Freiheit gegeben hat, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Wenn dies tatsächlich so ist, kann Gott unmöglich garantieren, wie die Entscheidungen der Menschen ausfallen werden. Das bedeutet nun, dass Gott nicht die perfekte Welt erschaffen kann, in der zu 100 % sein Wille geschieht.
Kurzfassung
Molina vertrat die Auffassung, dass Gott beschlossen hat, eine Welt mit freien Geschöpfen zu erschaffen und das ihm zugeteilte Blatt [= die Konsequenzen unserer freien Entscheidungen] so geschickt zu spielen, dass seine Endziele durch die freien Entscheidungen der Geschöpfe erreicht werden, trotz der sündigen Entscheidungen, die sie treffen würden, und des Bösen, das sie hervorbringen würden.
(Meister & Dew 2017:39)
Das bedeutet: Alles, was in dieser Welt geschieht, entspricht Gottes Willen, weil er sie so angelegt hat, wie sie ist. Er hat gesehen, dass dies die beste mögliche Welt für seine Schöpfung ist. Wie ein Profi-Schachspieler sieht er unsere Züge voraus und versucht das Böse, das wir erschaffen, einzugrenzen und in Gutes zu verwandeln.
Der bekannteste moderne Vertreter dieser Sichtweise ist William Lane Craig.
Pro
- Diese Erklärung ehrt den freien Willen der Menschen, da sie davon ausgeht, dass Gott die Welt so gestaltet, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können.
- Diese Sicht grenzt weder Gottes Allmacht noch seine Allwissenheit ein.
Kontra
- Gottes Lenken der Umstände kann als Manipulation ausgelegt werden, sodass der freie Wille in Wirklichkeit doch nur eine Illusion ist.
- Wie auch in der klassischen Sicht erlaubt, bzw.nutzt Gott das Böse, um seine Ziele zu erreichen.
Ansatz 3: Der offen theistische Ansatz
Der offene Theismus
Der Offene Theismus ist eine theologische Ansicht, die das klassische Verständnis von Gottes Allwissenheit infrage stellt. Die Kernideen des Offenen Theismus sind:
- Grenzen der Allwissenheit: Vertreter des Offenen Theismus glauben, dass Gottes Allwissenheit bedeutet, dass er alles weiß, was es aktuell zu wissen gibt. Gott weiß alles, was in der Vergangenheit war und in der Gegenwart ist, aber Dinge, die in der Zukunft geschehen, sind noch nicht festgelegt und deshalb offen. Zukünftige Ereignisse, insbesondere menschliche freie Entscheidungen, sind nach dieser Ansicht offen und ungewiss, sogar für Gott. Er kann zwar aufgrund seiner Erfahrung mit Menschen und dem Wissen über alle Umstände sehr gut abschätzen, wie sich Menschen entscheiden werden, aber 100% sicher kann er die Zukunft nicht voraussagen.
- Freier Wille und Mitwirkung: Diese Sichtweise betont den freien Willen der Menschen und sieht Gott als in Beziehung stehend und interaktiv mit seiner Schöpfung. Vertreter des Offenen Theismus glauben, dass Gott echte Beziehungen mit Menschen eingeht und auf ihre Gebete und Handlungen reagiert, soweit ihm das möglich ist, ohne den freien Willen der Menschen zu brechen.
- Offene Zukunft: Im Offenen Theismus ist die Zukunft nicht vollständig festgelegt, sondern zu einem gewissen Maße offen und flexibel. Gott kennt nicht die genaue Zukunft, die sich aus den freien Entscheidungen der Menschen ergibt.
- Leid und Böses: Offene Theisten argumentieren, dass Gott nicht jeden Aspekt der Schöpfung kontrolliert, sondern dass die Schöpfung festgelegten Kreisläufen und Regeln folgt. Deshalb werden Leid und Böses nicht direkt von Gott verursacht. Gott ist ein Partner inmitten allem Leid, der mitfühlend und tröstend wirkt.
- Der in Beziehung lebende Gott: Der Offene Theismus betont Gottes Beziehung zur Schöpfung. Er will mit uns Menschen Hand in Hand arbeiten, um seinen Willen zu verwirklichen und Leid zu bekämpfen.
Kurzfassung
Wir gehen davon aus, dass Gott vieles (nicht alles) von der Zukunft als das kennt, was geschehen könnte, und als das, was wahrscheinlich geschehen wird, aber nicht als das, was definitiv eintreten wird. Und das hat wichtige Auswirkungen auf die göttliche Vorsehung und das Problem des Bösen: Es bedeutet, dass Gott auch Risiken eingeht. Wenn Gott beschließt, eine bestimmte Situation herbeizuführen, in der seine Geschöpfe freie Entscheidungen treffen müssen, ist es selbst für Gott unmöglich, mit Sicherheit zu wissen, wie diese Geschöpfe reagieren werden; es besteht eine echte Möglichkeit, dass sie nicht so reagieren, wie er es beabsichtigt und wünscht. (Natürlich deutet vieles in der Bibel darauf hin, dass dies nicht nur möglich ist, sondern auch oft geschieht.)
(Meister & Dew 2017:60)
Ein häufiges und ständiges Eingreifen Gottes, um den Mißbrauch der Freiheit durch seine Geschöpfe zu verhindern und/oder den durch diesen Mißbrauch verursachten Schaden zu beheben, würde die im Schöpfungsplan vorgesehene Struktur des menschlichen Lebens und der Gemeinschaft untergraben; daher sollte ein solches Eingreifen nicht erwartet werden.
(Meister & Dew 2017:74)
Pro
- Der freie Wille des Menschen wird nicht von Gott eingegrenzt.
- Gott ist nie der Verursacher von Bösem.
- Passt gut zu allen Bibelversen, in denen Gott seine Meinung ändert oder die Zukunft von den Entscheidungen der Menschen abhängig macht.
Kontra
- Gottes Allwissenheit ist eingeschränkt.
Ansatz 4: Der Ansatz der essenziellen Kenosis
Diese Perspektive wurde von Thomas Jay Oord entwickelt, der sie ausführlich in seinem Buch „Gott kann das nicht“ erklärt.
Es gibt Dinge, die Gott nicht kann
Christen glauben traditionell, dass Gott allmächtig ist und alle Dinge souverän und ohne jede Einschränkung tun kann. Die Bibel selbst behauptet jedoch, dass Gott einige Dinge nicht tun kann. „Gott kann nicht lügen“ (Titus 1,2), „Gott kann nicht versucht werden“ (Jakobus 1,13), „Gott wird nicht müde“ (Jesaja 40,28). Und der Apostel Paulus verkündet: „Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden.“ (2. Tim. 2:13, NGÜ).
Gott kann sich nicht selbst verleugnen. Sein Wesen und sein Charakter bestimmen die Art und Weise, wie er in dieser Welt handelt. Gott kann nichts tun, was seinem Wesen widerspricht; deshalb ist seine Allmacht nicht unbegrenzt, sondern schließt alles aus, was seinem Wesen widerspricht.
Gottes Wesen ist nicht-kontrollierende Liebe
Gottes Wesen ist die sich selbst verschenkende, den anderen befähigende Liebe, und diese Liebe ist notwendigerweise nicht kontrollierend.
(Meister & Dew:84)
(Mehr zum Thema „Gottes Wesen ist Liebe“ finden Sie in meinem Artikel zu Wilfried Härles Dogmatik und zum Charakter Gottes.)
Einschränkung der Allmacht Gottes
Das bedeutet, dass Gott nichts tun kann, was seinem Wesen der Liebe widerspricht. Allerdings beschreiben verschiedene Menschen die Liebe sehr unterschiedlich. Daher muss die Liebe Gottes genauer definiert werden.
Diese These besagt, dass Gottes Wesen der Liebe es für Gott unmöglich macht, die Freiheit, die Handlungsfähigkeit oder die grundlegende Existenz anderer zu untergraben, außer Kraft zu setzen oder nicht zu garantieren. Dass Gott den Menschen in Liebe ihre Existenz schenkt, bedeutet auch, dass er die gesetzesähnlichen Regelmäßigkeiten – die viele als „Naturgesetze” bezeichnen -, die wir in der Welt am Werk sehen, nicht unterlaufen kann. Die sich selbst schenkende Liebe ist ein Aspekt von Gottes ewigem Wesen, und Gott kann dieses Wesen nicht verleugnen.
(Meister & Dew:85)
Oord argumentiert, dass wahre Liebe keinen Zwang ausübt und dementsprechend Gottes Liebe nicht kontrollierend ist. Wie im offenen Theismus bedeutet das, dass die Zukunft bis zu einem gewissen Grad offen ist, weil Gott nicht jedes Detail, das in dieser Welt geschieht, bis ins Kleinste hinein steuert. Wie sich die Zukunft im Einzelnen entfalten wird, hängt bis zu einem gewissen Grad von den Entscheidungen der Menschen ab.
Dementsprechend sind Leiden und Übel in erster Linie das Ergebnis des Missbrauchs der menschlichen Freiheit. Gott kann die Freiheit, die er den Menschen gegeben hat, nicht einfach außer Kraft setzen, und daher ist er nicht für das Böse in dieser Welt verantwortlich zu machen.
Kurzfassung
Insgesamt betont die essentielle Kenosis, dass Gott vieles Böse nicht stoppen kann, weil es seinem Wesen der nicht kontrollierenden Liebe widerspricht. Aber Gott will jederzeit mit uns zusammenarbeiten, um das Böse und Leid in dieser Welt zu überwinden.
Pro
- In allen anderen Sichtweisen kann Gott das Böse souverän stoppen, entscheidet sich aber dagegen und trägt damit eine Teilschuld. Die Perspektive der essentiellen Kenosis entlastet Gott von aller Mitschuld am Bösen, weil sein Wesen der nicht kontrollierenden Liebe es ihm unmöglich macht, das Böse ohne unsere Mithilfe zu stoppen.
- Der freie Wille des Menschen wird nicht von Gott in keinerlei Weise eingegrenzt.
Kontra
- Gottes Allmacht ist eingeschränkt.
Ansatz 5: Der skeptisch-theistische Ansatz
Vier Kernideen
Der skeptisch-theistische Ansatz (in „God and the Problem of Evil: Five Views“ vorgestellt von Stephen Wykstra) bietet keine wirkliche Erklärung für die Frage nach dem Leid. Es handelt sich um eine Perspektive zur Theodizee, die sich dem Problem des Bösen mit einer gewissen Demut nähert. Die Kerngedanken dieser Sichtweise sind:
- Begrenztes menschliches Verständnis: Dieser Ansatz legt nahe, dass unser Verständnis begrenzt ist und wir möglicherweise die Gründe für Gottes Zulassen bestimmter Übel nicht vollständig begreifen können. Wir können nicht mit Gewissheit beurteilen, ob eine bestimmte Instanz des Leidens wirklich sinnlos ist oder nicht, da uns das komplette Bild fehlt.
- Mögliche größere Gründe: Die skeptisch-theistische Sichtweise betont, dass es möglicherweise wichtigere Gründe gibt, die über unser Verständnis hinausgehen, die Gott durch die Existenz von Bösem und Leiden verfolgt. Demnach könnte das, was uns ungerecht oder schädlich erscheint, einem Zweck dienen, den wir nicht erfassen können.
- Demut im Urteil: Wykstra betont, dass wir in unseren Urteilen über die Gründe für Gottes Handlungen demütig sein sollten. Nur weil wir keinen Grund für bestimmte Übel sehen können, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es keinen gibt.
- Herausforderung für menschliche Logik: Diese Sichtweise stellt die Idee infrage, dass die menschliche Logik die Komplexitäten göttlicher Absichten vollständig erfassen kann. Sie deutet darauf hin, dass Gottes Wege unser Verständnis übersteigen könnten und dass wir nicht immer erwarten können, die Gründe für jedes Auftreten von Leid zu verstehen.
Kurzfassung
Insgesamt legt die skeptisch-theistische Sichtweise nahe, dass wir nicht voreilig den Schluss ziehen sollten, dass sich die Existenz von Bösem und Leiden und die Existenz eines guten und mächtigen Gottes widerspricht. Stattdessen sollten wir uns der Theodizee-Frage mit Demut nähern und erkennen, dass es Gründe gibt, die sich unserem begrenzten Verständnis möglicherweise verschließen. Außerdem sollten wir akzeptieren, dass wir göttliche Absichten durch unsere Vernunft vielleicht gar nicht vollständig erfassen können.
Pro
- Diese Sicht betont zu Recht, dass unser menschliches Verständnis limitiert ist und wir deshalb mit Demut das Thema betrachten sollten.
Kontra
- Dieser Ansatz beantwortet das Problem des Leids nicht.
Fazit
Bei der Suche nach Antworten auf die Theodizee-Frage wird deutlich, dass es verschiedene Ansätze gibt, um den Zusammenhang zwischen Gottes Allmacht, seiner Güte und der Existenz von Leid zu erfassen. Die Komplexität dieser Frage erfordert es, dass wir anerkennen, dass es keine einfachen Lösungen auf komplexe Fragen gibt.
Unsere Suche nach Antworten sollte von Demut geprägt sein. Letztlich liegt es an uns, einen Umgang mit dieser Frage zu wählen, der mit den Lehren Jesu und der Offenbarung Gottes in Jesus in Einklang steht. Aber auch wenn wir keine Antwort auf die Frage finden können, dürfen wir Gott vertrauen, dass er am Ende alles gut machen und Gerechtigkeit für jeden Menschen herstellen wird. Und so möchte ich mit den Worten Bonhoeffers enden, der diese Zeilen mitten im tiefsten Leid schrieb:
Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern, //des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, //so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern //aus Deiner guten und geliebten Hand.
Bibliografie
Meister, C. und Dew, J.K., Jr. (Hrsg.) God and the Problem of Evil: Five Views. Downers Grove, IL: IVP Academic: An Imprint of InterVarsity Press (Spectrum Multiview Books).

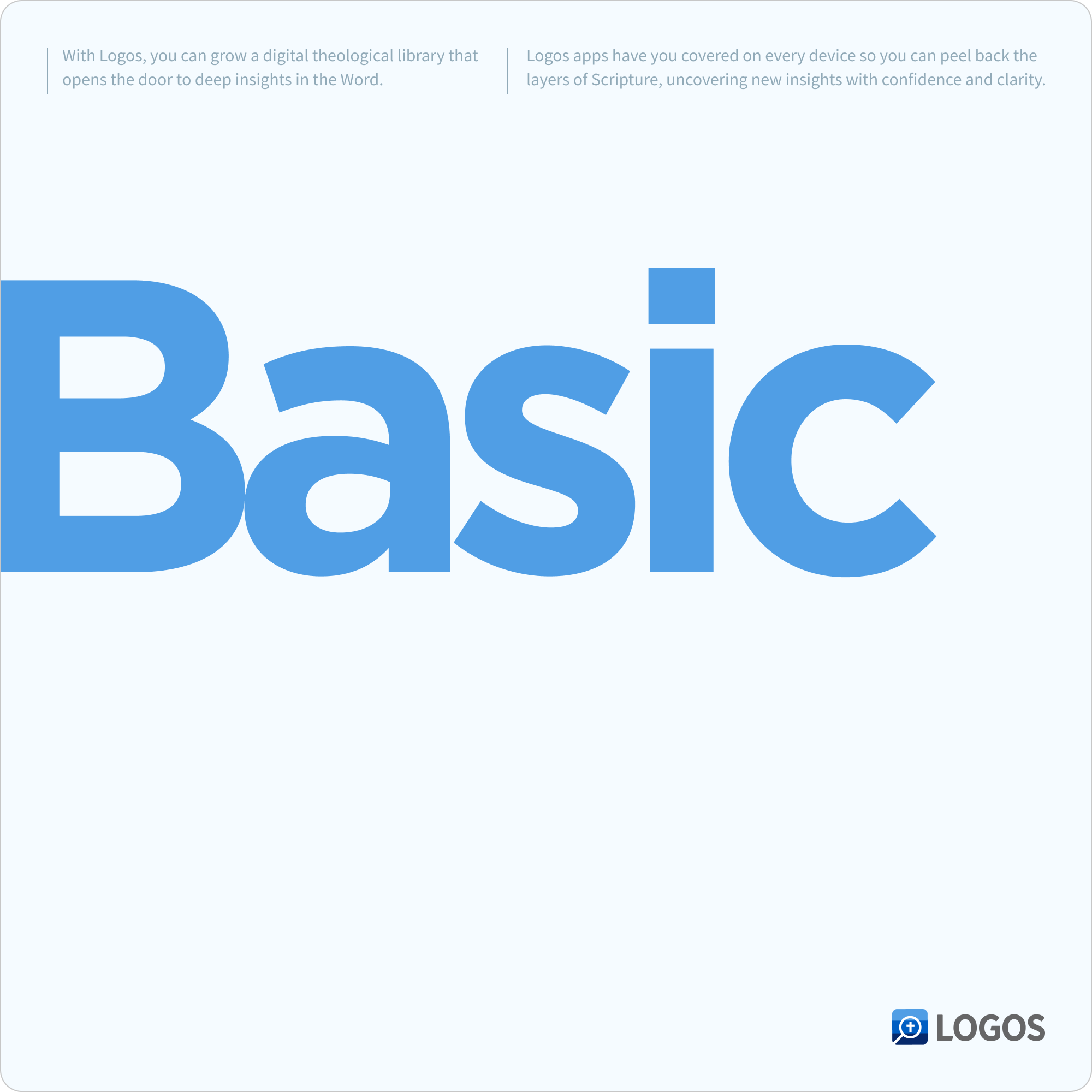
das molistische Konept spricht mich am natürlichsten an.
Und auch gibt es vielfätige Zeugniss von Menschen, dass Gott Vater, Jesus Christus durch Heiligen Geist sogar sprachlich und in direkter Weise eingegriffen hat zum Guten einer Person.
Eigentlich sollte ja jeder Mensch durch den Geist Gottes sein Denken erneuern (lassen) .
Vielen Dank für die Teilen.
Hallo,
habe am Wochenende mit Vielen Menschen gesprochen. Dabei kommt immer wieder die Frage nach dem Leid zur Sprache. Mit dem großen Nachteil, dass Die Menschen an dieser Frage stehen bleiben und mit Gott brechen.
Deshalb ist diese Vortrag sehr wichtig.
Aber wer ist (Meister & Dew 2017:26)?
Vielen Dank für den Kommentar.
Meister und Dew sind die Herausgeber von dem Buch, auf dessen Inhalt ich den Artikel aufgebaut habe.
Das Buch ist 2017 erschienen und die Zahl nach dem Doppelpunkt gibt an, auf welcher Seite sich das Zitat befindet.
Die komplette Biografie des Buches ist
Meister, C. und Dew, J.K., Jr. (Hrsg.) God and the Problem of Evil: Five Views. Downers Grove, IL: IVP Academic: An Imprint of InterVarsity Press (Spectrum Multiview Books).
Danke Manuel,
sehr schoen.
Eine Kleinigkeit, muesste es hier: „deshalb ist seine Allmacht nicht unbegrenzt, sondern schließt alles aus, was seinem Wesen widerspricht.”
nicht heissen: deshalb ist seine Allmacht nicht BEGRENZT, sondern schließt alles aus, was seinem Wesen widerspricht?
Sonst bliebe durch deine doppelte Verneinung: nicht unbegrenzt = begrenzt;
vermutlicht wolltest du aber schreiben nicht begrenzt = unbegrenzt, oder?
Keine der fuenf Antworten beruecksichtigt scheinbar eine VORHER (im Paradies) NACHHER (nach dem Rauswurf) Situation? Eine solche scheint mir aber wahrscheinlich?
Du hast ja das ganze Buch gelesen, kommt diese Beruecksichtigung bei gar keiner These vor?
Oder spielt das keine Rolle, deiner Meinung nach?
In der Bibel kommen Wendungen wie „verstockt” „dahingegeben” „Gott machte sein Herz hart” vor.
Welche der 5 Antworten beruecksichtigt, dass wir entweder nicht immer (in jeder Lebenssituation) und/oder nicht alle Menschen immer einen freien Willen zur freien Entscheidung haben?
Auch hier punktet mE Antwort 5 am Besten (ich weiss, dass ich nix weiss, aber Gott ist groesser)
LG Joerg
Hi Joerg.
Danke für deinen Kommentar. Du hast recht, dass die doppelte Verneinung es etwas schwer verständlich macht, aber tatsächlich argumentiert Oord, dass Gottes Allmacht durch sein Wesen der Liebe eingegrenzt ist. Laut Oord, kann Gott nicht tun und machen, was er will, weil etwas Böses zu tun würde seinem Wesen widersprechen und deshalb kann er es nicht tun. Es gibt ja verschiedene Verse, die darauf hindeuten, dass Gott nicht alles tun kann: „Gott kann nicht lügen“ (Titus 1,2), „Gott kann nicht versucht werden“ (Jakobus 1,13), „Gott wird nicht müde“ (Jesaja 40,28). Und der Apostel Paulus verkündet: „Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden.“ (2. Tim. 2:13, NGÜ).
Ich kann mich nicht erinnern, dass die VORHER-NACHHER-Situation thematisiert wurde, aber es ist auch schon wieder etwas her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber diese Situation geht von einem wörtlichen Verständnis von 1 Mose 1–3 aus, was ja auch von vielen Theologen bereits nicht geteilt wird.
Ich finde deine Frage zum Thema „Herzen verstockt“ spannend. Ich denke, das ist definitiv ein relevanter Faktor für das Leid-Thema. Allerdings würde ich persönlich eher in die Richtung von 2 Kor 4,4 denken: dass der Gott dieser Welt die Augen verblendet, statt dass Gott aktiv Herzen verhärtet.
Ich vermute, dass selbst die stärksten Vertreter des freien Willen, sich sehr wohl bewusst sind, dass unser freier Wille stark beeinflusst ist von unserer Kultur, Erziehung und dem Zeitgeist. Niemand trifft 100% freie Entscheidungen. Wir sind alle „Kinder unserer Zeit“. Ich verstehe die Rede vom freien Willen eher als den Fakt, dass wir echte Entscheidungen treffen können, also im Gegensatz dazu, dass Gott diktiert, wie wir entscheiden. Aber ich denke, dass wir alle ein gewisses Maß an Verblendung/Verstockung haben ist ganz natürlich.
Antwort 5 betont diese Eingrenzung unseres Wissens natürlich am stärksten, da hast du recht.
LG Manuel
Danke, Manuel
Bsp f Verstockung: https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/verstockung‑1/
Pharao, Glaube an Christus: sehen ohne erkennen, hoeren ohne verstehen (Mk 4); Folge von Bindung an Schuld (Welt, Rö 1) oder voruebergehende Ablehnung von Christus durch das Volk Israel (Rö 11)
https://www.bibelwissenschaft.de/ressourcen/wibilex/altes-testament/verstockung-at
„Der Verstockungsgedanke führt an den Rand des rational Nachvollziehbaren und theologisch Aussagbaren. Er ist eine äusserste Konsequenz aus dem Glauben an nur einen Gott
Verstockte werden [trotzdem] für ihr Tun und Lassen zur Rechenschaft gezogen
Das negative Einwirken Gottes auf einen Menschen enthebt diesen nicht der Verantwortung für sein negatives Tun; ein verstockter Mensch ist nicht etwa von Gott besessen, sondern bleibt im Besitz seiner geistigen und seelischen Kräfte.
Pharao (Gewaltherrscher 2.Mo 7): Gott verhängt die Verstockung also nicht über einen ahnungslosen oder gar gutwilligen Menschen, sondern bestärkt einen, der das Verkehrte will und tut, in seiner Haltung.
nordisraelitischer König (Kriegsabenteurer, 1.Kö 22): Die Verstockungstheorie antwortet: Macht ist verführerisch, macht blind und taub. Sie sträubt sich gegen Versuche ihrer Kontrolle oder Begrenzung. Sie suggeriert denen, die sie innehaben, das Gefühl fast göttlicher Allmacht – und trägt damit den Keim des Todes in sich. Denn der eine Gott duldet keine Götter neben sich, auch keine sich selbst vergottenden Menschen.
Verstockung des Volkes von Israel/Juda (Abgefallene, an Schuld/Suende Festhaltende, Jes 6): Herz ist Ort des Verstockungsvorgangs (hebr.: Sitz nicht des Gefühls, sondern des Verstandes und des Willens), Augen und Ohren werden ausgeschaltet.
Das Theologumenon der Verstockung ist also ein Versuch, das Verhältnis von Gottes Macht und menschlicher Macht so zu bestimmen, dass dabei weder die Verantwortung der Menschen aufgehoben noch der Glaube an die Souveränität Gottes aufgegeben wird.
Verstockungsfahrplan fuer Individuen/Volk Gottes: Zuerst, weil es nicht will, dann zunehmend, weil es nicht [mehr] kann.
Verstockungs-Tatbestand hält dazu an, Widersprüchlichkeiten in der Welt- und in der Gotteserfahrung auszuhalten.”
Ich wuensche uns sowohl Ehrfurcht als auch Gewissheit, nicht tiefer als in Gottes Hand fallen zu koennen 😊
LG Joerg
Danke, Joerg für diese kurze aber informationsreiche Übersicht über das Thema Verstockung. Spannendes Thema. Da werde ich wohl noch ein wenig weiter drüber nachdenken müssen.
Danke für die Starthilfe.
LG
Manuel