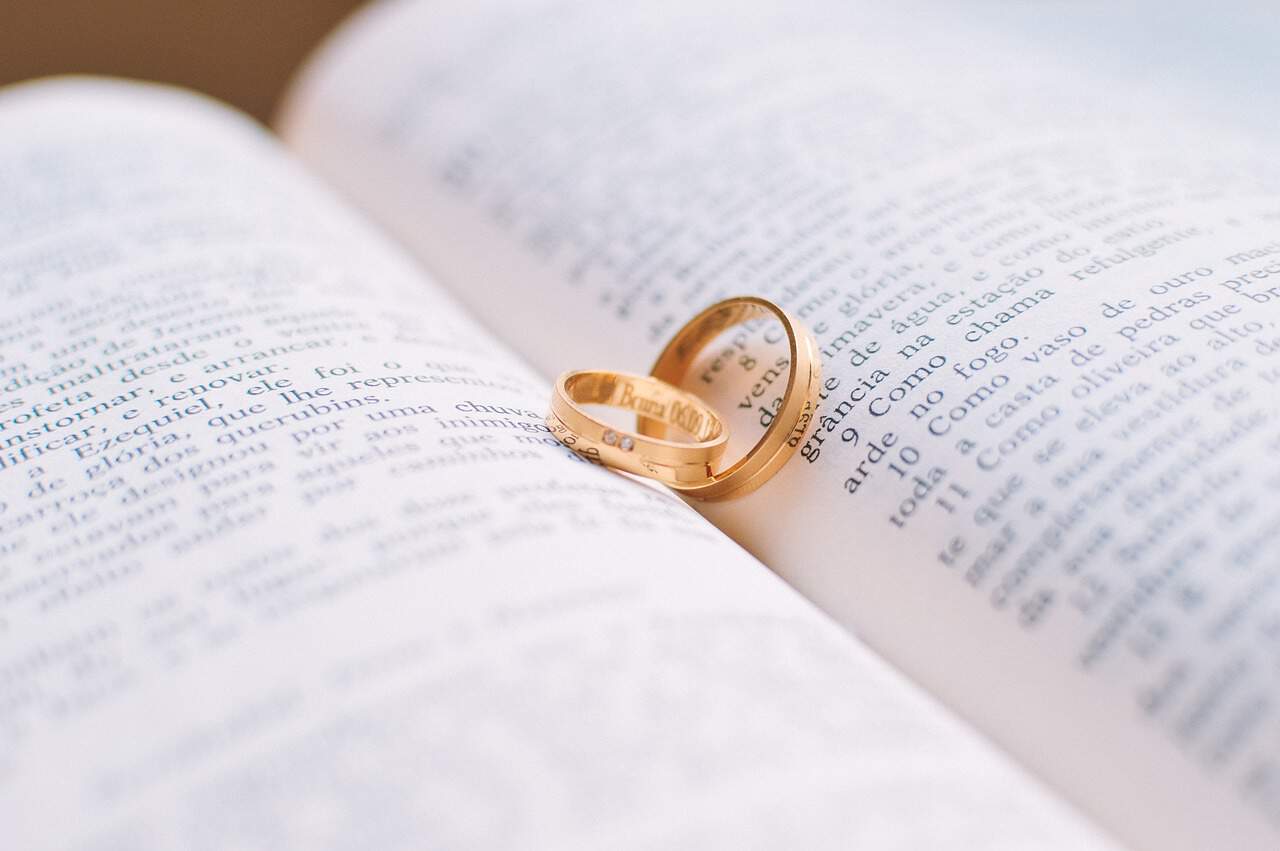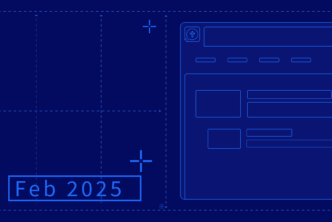Kontrovers! Wie das Hohelied korrekt ausgelegt werden sollte, ist ohne Frage sehr umstritten. Verschaffen Sie sich in 15 Min. selbst ein umfassendes Bild über die existierenden Deutungsansätze und allem Weiteren, was Sie zu dem Hohelied wissen müssen.
Inhalt
Das Hohelied-ein umstrittenes Buch
Das Hohelied—es ist „das schönste aller Lieder“ (Egelkraut 2012:770). Ein biblisches Buch gefüllt mit erotischen Bildern und Halb-Andeutungen (Fishbane 2015:xxvii). Rabbi Akiba bezeichnete das Hohelied als das heiligste aller Bücher (m. Yadayim 3:5 Q). Egelkraut nennt es „das allerschwierigste Buch des AT“ (2012:769). Ein heiliges Buch, welches ohne Scham die Schönheit des männlichen und des weiblichen Körpers feiert (Egelkraut 2012:771).
Manche Rabbinen verboten das Lesen des Buches für Personen unter dreißig Jahren, wegen seines erotischen Inhalts (Fruchtenbaum 1983:1). „Nach dem Zeugnis des Talmuds und der Mischna wurde es auf Hochzeiten, in Kneipen und bei Spielen in den Weinbergen gesungen“ (Egelkraut 2012:771). Ein biblisches Buch, in dem weder Gott noch Israel, Bundesverpflichtungen oder religiöse Regeln erwähnt werden (Fishbane 2015:xix). Bis heute streiten die Theologen, wie das Hohelied verstanden werden sollte. Was ist der richtige Umgang mit diesem erotischen Liebeslied in der Heiligen Schrift? Welche Relevanz hat es für unsere moderne Zeit?
Verfasserschaft des Hohelied
Es gibt viele verschiedene Vermutungen, wer das Hohelied verfasst hat und wann es geschrieben wurde. Unter Berufung auf Hld 1,1 gilt Salomo als der traditionelle Verfasser des Buches. Allerdings erklärt Longman (2001:3), dass die hebräische Präposition in Hld 1,1 auf vier unterschiedliche Weisen verstanden werden kann:
An Salomo: Das Buch ist Salomo gewidmet. Von Salomo: Salomo ist der Autor. Betreffend Salomo: Salomo ist das Thema des Buches. Salomonisch: Das kann so viel bedeuten wie „in der salomonischen/weisheitlichen Literaturtradition”.
Egelkraut meint, dass eine Geliebte vom Lande, wie Sulamit im Hohelied dargestellt wird, schwer mit dem „politisch motivierten Ehe- und Liebesleben Salomons vereinbar“ ist (2012:773). Longman ergänzt, dass Salomo nur an drei Stellen im Hohelied erwähnt wird und dass Salomo ein Protagonist des Gedichts ist, nicht sein Komponist (2001:6). Egelkraut weist weiterhin darauf hin, dass Salomo im Hohelied „eine distanzierte und unwirkliche Figur“ ist und Salomo in Hld 8,11–12 sogar in „negativ-abgrenzender Weise“ erwähnt wird (2012:773). Deshalb schlussfolgert Egelkraut, dass Salomo als Autor des Buches „insgesamt wenig passend erscheint“ (:773) und vermutet, dass der Vermerk Salomos in Hld 1,1 als Widmung oder Klassifizierungsvermerk zu verstehen ist: „nach der Weise bzw. im Stil Salomos“ (:772).
Eine weitere umstrittene Theorie ist, dass das Hohelied von einer Frau geschrieben wurde, die sich gesellschaftlichen Normen widersetzte, einschließlich der Vorstellung, dass Frauen Empfängerinnen und nicht Initiatorinnen der Liebe zu sein hätten (Longman 2001:8). Ein Hinweis darauf ist, dass 61 der 117 Verse im Hohelied der Frau zugeordnet werden können und dass mehrere Stellen so feminin sind, dass es schwer vorstellbar ist, dass ein Mann diese Stellen geschrieben hat (Longman 2001:7).
Die Wahrheit ist, dass viele Vermutungen zur Verfasserschaft existieren, aber am Ende ist es wahrscheinlich am ehrlichsten zuzugeben, dass es unmöglich ist, den Autoren mit Sicherheit zu identifizieren (Murphy 1992:150).
In dem Wissen, dass eine genaue Identifizierung des Autors nahezu unmöglich ist, sei doch erwähnt, dass das Hohelied vermutlich eine Sammlung an Liebesgedichten, von eventuell sogar unterschiedlichen Autoren ist und es demnach möglich ist, dass einige dieser Gedichte von Salomo selbst oder eben teilweise von einer Frau geschrieben wurden, aber auch dies ist nur Spekulation.
Entstehungszeit des Hohelied
Das Datum und der Ursprung des Hohelieds Salomos sind höchst umstritten. Die Daten reichen vom zehnten Jahrhundert (frühe monarchische Periode) bis zum zweiten Jahrhundert v. Chr., aber die meisten Experten favorisieren ein postexilisches Datum zwischen dem vierten und zweiten Jahrhundert v. Chr. (Bandstra 2011:981).
Pope (2008:26) erklärt, wie es zu so einer großen Spanne an möglichen Entstehungszeiten kommen kann:
Das datierbare Material des Liedes umspannt fünf Jahrhunderte, von Salomos Thronbesteigung um 960 v. Chr. bis zur persischen Zeit. Die Unterschiede in der Sprache und in den geografischen Orten, der Wechsel von ländlicher Einfachheit in einigen Texten zu städtischer Raffinesse in anderen, legen eine unterschiedliche zeitliche und örtliche Herkunft der verschiedenen Lieder nahe.
In Anbetracht der großen möglichen Zeitspanne sollte im Kopf behalten werden, dass eine genaue Datierung der Entstehungszeit sehr schwierig ist. Pope (2008:27) bringt dies gut auf den Punkt:
Das Spiel mit der Datierung, wie es bei biblischen Büchern wie Hiob und dem Hohelied sowie bei vielen Psalmen gespielt wird, bleibt ungenau, und das Ergebnis ist schwer zu errechnen. Es gibt Gründe sowohl für die ältesten als auch für die jüngsten Schätzungen.
Damit wird klar, dass eine genaue Datierung unmöglich ist und nur Vermutungen zur Entstehungszeit angestellt werden können.
Egelkraut lehnt zwar Salomo als Verfasser des Buches ab, schlussfolgert aber dennoch, dass „Rahmen, Atmosphäre und Ton des Liedes durchaus die salomonische Zeit widerspiegeln“ (2012:775).
Fishbane (2015:xxi) hingegen schlägt eine Entstehung über mehrere Jahrhunderte vor:
Solche Überlegungen und das Auftreten vieler kurzer und oft unzusammenhängender Einheiten im Hohelied stützen die Ansicht der Gelehrten, dass das Hohelied eine Sammlung von Texten ist, die über viele Jahrhunderte hinweg verfasst wurden – beginnend (vielleicht) in der Mitte des zehnten Jahrhunderts vor Christus und weiterführend bis zum fünften oder vierten Jahrhundert vor Christus, als das Hohelied so etwas wie seine heutige Form erhielt. Kurz gesagt, das Hohelied ist eine Sammlung von Liebesliedern, die im alten Israel über einen Zeitraum von Jahrhunderten entstanden sind. Erst dann – als literarisches Ganzes – wurde dieses Werk zur Heiligen Schrift.
Murphy bestätigt, dass die moderne Forschung dazu tendiert, das Hohelied in die nachexilische Zeit zu datieren (1992:150). In Anbetracht der erwähnten Informationen sollte jegliche Datierung des Hoheliedes mit Demut vorgeschlagen und nicht als letztes Wort verstanden werden.
Die Struktur: eine Sammlung an Liedern oder eine einheitliche Gesamthandlung?
Die Frage nach der Struktur des Liedes ist eine schwierige Frage, wie die Fülle von Hypothesen in der Sekundärliteratur zeigt. Keine zwei Gelehrten sind sich im Detail einig, obwohl es so etwas wie Denkschulen zu diesem Thema gibt (Longman 2001:54).
Die Herangehensweise an die Struktur des Hoheliedes wird stark von der Identifizierung der Literaturgattung beeinflusst. Diejenigen, die das Hohelied als das Liebesdrama eines Paares verstehen, setzen sich für eine einheitliche Gesamthandlung des Buches ein, während die, die glauben, dass es sich bei dem Hohelied um eine Sammlung von Liebesgedichten handelt, sich oft nicht über die Kohärenz der Sammlung als Ganzes einig sind (:55).
Das Hohelied als eine einheitliche Gesamthandlung
Athas gibt zu, dass viele Kommentatoren an der mühseligen Aufgabe verzweifelt sind, einen narrativen Faden zu finden, der das Hohelied zusammenhält und dass dabei oft zu viel in den Text hineingelesen wird (2020:254). Trotzdem glaubt er, dass das Hohelied die Geschichte eines jungen verliebten Paares erzählt, welches damit konfrontiert ist, dass die Brüder des Mädchens eine große Mitgift erlangen wollen, indem sie das Mädchen mit Salomo vermählen. Die Verlobung des Mädchens mit Salomo überschattet das Liebesglück des jungen Paares. Somit wird das Mädchen gleich doppelt ausgenutzt, sie dient den Brüdern als Mittel zum Geld und dem lüsternen Salomo als weitere erotische Trophäe in seinem großen Harem.
Um dieser Ungerechtigkeit zu entgehen, beschließt das verliebte junge Paar miteinander zu schlafen, obwohl sie nicht verheiratet sind (:258). Damit sollen die Brüder gezwungen werden, ihnen die Eheschließung zu gewähren (Ex 22,16–17) (:334). Die Gefahr dabei war aber, dass auch eine Steinigung als Bestrafung des Paares möglich war (Deut 22,23–24). Athas beschreibt die Situation als eine gesetzliche Grauzone und vermutet, dass das Schicksal des Paares in der Hand der Brüder lag. Entweder die geldgierigen Brüder erlaubten die Hochzeit des jungen Paares oder sie steinigten ihre Schwester, würden dann aber jegliche Mitgift verlieren (:258).
In ihrer Geldgier versuchen die Brüder das Geschehene zu vertuschen und ihre Schwester trotz allem mit Salomo zu vermählen. Das Hohelied schließt mit einem offenen und tragischen Ende, bei dem Salomo kommt, um das Mädchen zu holen und das Mädchen ihrem Geliebten zuruft zu fliehen (:258).
Athas scheint es am plausibelsten, die Komposition des Liedes in die Zeit um 166 v. Chr. zu legen, während der Hochphase der antiochenischen Verfolgung und des ersten Ausbruchs des Makkabäeraufstands, als das Judentum um sein Überleben kämpfte und darüber nachdachte, wie es am besten auf die zunehmende Herausforderung des Hellenismus reagieren sollte (:252). Mit diesem historischen Hintergrund schlägt er vor, dass die Geschichte des jungen Paares ebenfalls auf die Situation Israels zu dieser Zeit übertragen werden kann. Das junge Paar steht für Israel und Gott, wessen Glück von dem gierigen Despoten Salomo bedroht wird, der für die Unterdrücker der damaligen Zeit steht. Dementsprechend fasst Athas sein Verständnis vom Hohelied wie folgt zusammen:
Das hellenistische Milieu, in dem das Lied spielt, ist wichtig. Die Botschaft des Liedes handelt von menschlicher Liebe, Sexualität, Macht, Menschsein, Monogamie und Polygamie. Die Botschaft des Liedes ist der Kampf des Judentums, seine orthodoxen, biblischen Prinzipien und Hoffnungen angesichts der schwachen lokalen Führung und des enormen hellenistischen Drucks – sowohl des kaiserlichen als auch des kulturellen Drucks – während der Antiochener-Verfolgung im zweiten Jahrhundert v. Chr. zu bewahren (2020:263).
Ich denke eine einheitliche Handlung im Hohelied zu sehen ist problematisch, aber die Auslegung von Athas ist meines Erachtens der durchdachteste Versuch, eine einheitliche Handlung im Hohelied zu finden und ist, ein möglicher Weg, das Hohelied zu verstehen. Allerdings wirkt es gelegentlich so, als müsste man den Text sehr verbiegen, um die entsprechende Auslegung zu bekommen und es ist fragwürdig, ob die jüdischen Autoren den großen König Salomo gewählt hätten, um die verhassten Unterdrücker zu repräsentieren.
Das Hohelied als eine Sammlung von Liebesgedichten
Egelkraut hingegen versteht das Hohelied als eine Sammlung von Liebesliedern, wobei er mehrere „verschiedene Gattungen des Liebesliedes“ im Hohelied identifiziert, wie Sehnsuchtslieder (z. B. Hld 1,2–4), Bewunderungslieder (z. B. Hld 1,9–11) oder Beschreibungslieder (z. B. Hld 4,1–7) (2012:776). Den Versuch, in dieser Vielfalt an Liebesliedern, „eine Einheit der Gedankenführung zu demonstrieren, hat man weitgehend aufgegeben“ (:782). Trotzdem ist das Hohelied keine willkürliche Sammlung an Liebesliedern. Eine durchgängige Grammatik und Syntax, ähnliches Vokabular und ein konstanter Stil verbinden die Liebeslieder und machen sie zu einem hochpoetischen Lied (:783). Egelkraut beschreibt das Hohelied als „ein künstlerisches Gesamtgebilde, dem frühere Volkslieder zugrunde liegen mögen, die aber jetzt zu einem Ganzen zusammengearbeitet sind“ (:783).
Auch Longman versteht das Hohelied als ein einziges Lied, das aus vielen verschiedenen Liedern zusammengesetzt ist. Die literarische Einheit des Hoheliedes zeigt sich, laut Longman, in den sprachlichen Echos des Buches, der Konsistenz der Charaktere, der Wiederholung von Szenen und Refrains, die sich durch das Buch ziehen (2001:55–56).
Dementsprechend gilt für die Struktur des Hoheliedes:
Das Hohelied ist eine Sammlung von Liedern über ein gemeinsames und im Allgemeinen erotisches Thema, […], die durch Anspielungen und die Wiederholung von Schlüsselvokabeln geschickt zusammengeschweißt sind, aber keine erzählerische Zeitlinie bieten, die sich durch das Werk zieht (Longman 2001:56).
Es herrscht kein allgemeiner Konsens darüber, wie viele individuelle Gedichte sich im Hohelied befinden.
Nach der Analyse von Keel (:18) besteht das Hohelied aus zweiundvierzig einzelnen Gedichten. Murphy (:65–67) geht von neun Abteilungen im Hohelied aus. Longman (:viii) sagt, dass es dreiundzwanzig Gedichte gibt, und Goulder (Song of Fourteen Songs) sagt, dass es vierzehn Gedichte gibt. Die Platzierung der Absatzmarkierungen im MT legt nahe, dass es neunzehn Gedichte gibt (Garrett 2004:25–26).
Longman macht darauf aufmerksam, dass meistens subtile Manipulation nötig ist, um das Hohelied in feste Muster zu zwingen (2001:56).
Die Vielfalt an Sichtweisen zeigt, dass es sehr unterschiedliche Meinungen zum Aufbau des Hoheliedes gibt. Deshalb sollte auch hier jeder Vorschlag eines Aufbaus mit Demut betrachtet werden.
Möglichkeiten der Auslegung
Wie das Ziel des Hoheliedes verstanden wird, ist stark von der gewählten Auslegung des Buches abhängig. Durch die Jahrhunderte hindurch wurde das Hohelied sehr unterschiedlich gedeutet. Curtis (2013:115) erinnert, dass die Vielfalt der vorgeschlagenen Interpretationsmöglichkeiten jeden Ausleger zur Demut führen sollte:
Vielleicht in größerem Maße als bei jedem anderen Buch der Bibel ist es unmöglich, eine bestimmte Sichtweise des Buches als die richtige Interpretation zu präsentieren. Von mehreren Vorschlägen für die Deutung des Hoheliedes kann man sagen, dass „diese spezielle Lesart des Hoheliedes als eine von mehreren angeboten wird, die plausibel und aus dem Text selbst heraus vertretbar sind, ohne die Bedeutung des Textes übermäßig zu ’strapazieren’ oder in den Text ‚hineinzulesen’, was nicht da ist.
In Anbetracht dieser Tatsache präsentiere ich hier eine Übersicht der gängigsten Interpretationsmöglichkeiten und ein paar der Argumente, die für oder gegen die jeweilige Auslegung sprechen.
Die allegorische Auslegung
Beginnend mit Rabbi Akiba (ca. 50–135 n. Chr.) bis „ins 17. Jh. herrschte die allegorische Auslegung vor“ (Egelkraut 2012:778–779). Rabbi Akiba verstand das Hohelied „als Abbild der Liebe Gottes zu Israel“ (:779). Die Kirchenväter, z. B. Origenes, Hieronymus, Gregor von Nyssa, Gregor der Große und Augustinus (Garrett 2004:64), übernahmen diese allegorische Leseart, mit dem Unterschied, dass sie das Hohelied als Abbild der Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde verstanden (Egelkraut 2012:779).
Garret (2004:66) kommentiert am Beispiel von Origenes, dass die allegorische Auslegung der Kirchenväter oft sehr willkürlich wirkte.
Origenes kümmert sich nicht um eine logische Struktur der Verbindungen, die er herstellt; er stellt eine Reihe von Bibelzitaten zusammen, die er nach dem Vorbild der Konkordanz nach einem Wort in der Bibel anordnet. Das Endergebnis ist eine Reihe von Bibelzitaten, die ein breites Spektrum von Themen abdecken, aber keinen wirklichen Zusammenhang mit dem vorliegenden Text aufweisen. Oft gibt es keine sinnvolle Verbindung zwischen den Assoziationsketten, die er schmiedet, und dem Text des zugehörigen Liedes – oder sogar mit einer allegorischen Auslegung dieses Textes.
Dieses Beispiel zeigt bereits, dass die allegorische Auslegung die Gefahr der Willkür birgt, da weder das Hohelied noch das Neue Testament explizite Hinweise geben, wie das Hohelied verstanden werden sollte (:779). So wurden etwa die zwei Brüste der Frau (Hld 4,5) von Hippolyt symbolisch verstanden für das Alte und das Neue Testament (Longman 2001:28).
Im Hohelied selbst findet sich kein Hinweis darauf, dass es allegorisch verstanden werden will. Die Propheten im Alten Testament haben gewöhnlich Hinweise gegeben, wenn etwas allegorisch verstanden werden sollte (Hos 1,2; Jes 62,6), aber im Hohelied fehlen jegliche solcher Hinweise (Steinberg 2014:23). Im Gegenteil, das Hohelied „ist von der ersten bis zur letzten Zeile so ohne Gott und ohne jede Religion“ (:785), dass es schwerfällt es in theologische Dogmen zu pressen.
Ferner beschreibt das Hohelied „ein erotisches und auch körperbetontes Liebesverhältnis“ (:23). Diese explizite erotische Sprache ist schwer verständlich, wenn das Thema des Buches die Liebe zwischen Gott und seiner Gemeinde ist.
Origenes und Hieronymus hatten beide ein sehr schwieriges Verhältnis zur Sexualität und legten das Hohelied dementsprechend allegorisch aus. Ihr großer Einfluss auf das Christentum führte maßgeblich dazu, dass das Hohelied in den kommenden Jahrhunderten allegorisch ausgelegt wurde (Longman 2001:30–31).
Die typologische Auslegung
Die typologische Auslegung „findet das Hauptthema in der Liebe und Verbundenheit der Liebenden“ (Egelkraut 2012:779), aber überträgt diese Liebe ebenfalls auf die Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Somit bekommt das Hohelied eine doppelte Bedeutung: die direkte Aussage und die Übertragung auf Christus und seine Gemeinde.
Eine große Gefahr der typologischen Auslegung des Hohenliedes besteht darin, dass unter der Hand doch wieder die geistliche Ebene zur eigentlichen Ebene wird, dass man den Gottesbund zur Hauptsache und den Ehebund zur Nebensache macht (Steinberg 2014:24).
Weiterhin weist Steinberg darauf hin, dass die Liebe zwischen Mann und Frau nicht nur Abbild, sondern vielmehr Ausdruck des Bundes mit Gott ist (:24). „Ehe ist gelebter Glaube“ (:24). Das Hohelied „spricht über den Ehebund, nicht über den Gottesbund“ (:25).
Die dramatische Auslegung
Die dramatische Auslegung versteht das ganze Hohelied als ein einheitliches Liebesdrama mit zwei (Salomo und Sulamit), oder manchmal auch drei (der Hirte, Sulamit und Salomo), Hauptdarstellern (Egelkraut 2012:280). Der Fakt, dass die Vertreter der dramatischen Auslegung sich nicht einig sind, wie viele Hauptdarsteller es gibt, wer die Hauptdarsteller sind und wer genau in wen verliebt ist, zeigt bereits, dass diese Auslegung nicht natürlich aus dem Text herausfließt.
Zusätzlich ist diese Auslegung problematisch, weil zudem keine Hinweise im Text dafürsprechen. Der Text enthält keinerlei Regieanweisungen. Es gibt keine Erzählerstimme, die den Leser leitet. Und in etwa 10 Prozent der Fälle ist nicht einmal mit absoluter Sicherheit erkennbar, wer genau spricht (Longman 2001:42–43).
Steinberg (2014:46) argumentiert folgendermaßen gegen eine dramatische Auslegung:
Wer einen Sachtext verfasst, ist normalerweise bemüht, sich möglichst klar und verständlich auszudrücken, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Literarische Texte hingegen lassen bestimmte Dinge bewusst unausgesprochen. Wenn eine Botschaft vermittelt werden soll, wird diese oft nicht direkt in Worte gefasst, sondern muss vom Leser erschlossen werden. Dies gilt in verstärktem Maße für die Poesie, die mit Andeutungen und Anspielungen arbeitet und den Leser herausfordert, die Hintergründe und Zusammenhänge, die für das Verständnis notwendig sind, selbst zu ergänzen.
Das Hohelied ist für Steinberg ein Paradebeispiel für solch einen poetischen Text und das Hohelied strebt somit keine Vereinheitlichung an, sondern lässt in seinen einzelnen Gedichten unterschiedliche Facetten des Beziehungsgeschehens zwischen Mann und Frau aufleuchten (:49).
Das Hohelied als eine einheitliche Sammlung von Liebesliedern
Diese Auslegung versteht das Hohelied als eine Sammlung von Liebesgedichten. Manche Ausleger kommen zu dem Schluss, dass diese Gedichte keine einheitliche Geschichte erzählen, sondern eher wie eine Anthologie an Liebesgedichten durch das gemeinsame Thema der Liebe zwischen Mann und Frau verbunden sind (Curtis 2013:114). Andere Ausleger verstehen das Hohelied als ein einheitliches Lied, welches zwar aus verschiedenen separaten Liebesliedern zusammengesetzt ist, aber zu einem großen Ganzen zusammengefügt wurde. So sieht Egelkraut das Hohelied als „ein künstlerisches Gesamtgebilde, dem frühere Volkslieder zugrunde liegen mögen, die aber jetzt zu einem Ganzen zusammengearbeitet sind“ (Egelkraut 2012:783).
Die Themen dieser einzelnen Lieder gehören zu den alltäglichen Dingen des menschlichen Liebeslebens und der menschlichen Sexualität: die Sehnsucht nach der Gegenwart des Geliebten, die Freuden der körperlichen Nähe, die Berauschung an der Schönheit des Geliebten, die Überwindung sozialer Hindernisse und Hürden, um zusammen sein zu können (Weems 1997:372). Dies sind die Themen, die einer natürlichen Leseweise des Textes entspringen.
Folglich versteht diese Leseart das Hohelied als eine Art erotischen Psalter (Longman 2001:43), der die Liebe und die Sexualität eines Paares zelebriert.
Dieser Ansatz zwingt uns, die Bedeutung der Metaphern und Symbole im Kontext der altorientalischen Liebesdichtung zu suchen. Die Bilder sind keine theologischen, politischen, ideologischen oder philosophischen Chiffren. Außerdem befreit uns dieser Ansatz von der Notwendigkeit, die „Lücken” der Geschichte in der Art dramatischer Interpretationen zu füllen. (Garrett 2004:90).
Diese Leseweise war vermutlich das ursprüngliche und vorherrschende jüdische Textverständnis, bevor Rabbi Akiba die allegorische Auslegung verbreitete (Athas 2020:260; Fishbane 2015:xxi).
Weitere Vorschläge
Es gibt weitere Vorschläge, wie das Hohelied verstanden werden sollte, aber diese sind in der Regel nicht weit verbreitet und werden in der Literatur gewöhnlich als problematisch angesehen. Dazu zählt die Auslegung des Hoheliedes als ein syrischer Hochzeitsritus (Egelkraut 2012:780), als ein „Protest gegen kanaanäische Fruchtbarkeitskulte“ (:781) oder als Ankündigung von Maria als dem rettenden Gegenstück zu Eva (Garrett 2004:70).
Fazit
Wie das Hohelied genau verstanden werden sollte, ist schwer mit Klarheit zu sagen. Jede Interpretationsmöglichkeit muss sorgfältig und kritisch geprüft werden. Manche Möglichkeiten sind wahrscheinlicher als andere, aber schlussendlich muss jeder Leser selbst eine Interpretationsstrategie wählen, die mit dem gesamten biblischen Kontext und dem Charakter Gottes vereinbar ist.
Auch wenn viele Details unklar bleiben, ist es doch einigermaßen sicher zu sagen, dass das Hohelied die Liebe und Sexualität zwischen Mann und Frau lobt und dazu ermutigt, diese Geschenke Gottes im richtigen Rahmen zu feiern und zu genießen.
Im zweiten Teil zum Hohelied werde ich genauer betrachten, welche hochrelevante Botschaft das Hohelied auch für moderne Leser hat.
Bibliografie
Akin, Daniel L. (2015). Exalting Jesus in Song of Songs. Nashville: B&H Publishing Group.
Athas, George (2020). Ecclesiastes, Song of Songs. Grand Rapids: Zondervan Academic.
Curtis, Edward M. (2013). Ecclesiastes and Song of Songs. Grand Rapids: Baker Books.
Egelkraut, Helmuth u. a. (2012). Das Alte Testament: Entstehung, Geschichte, Botschaft. 5. Aufl. Gießen: Brunnen Verlag.
Garrett, Duane (2004). Song of Songs, Lamentations. Nashville: Thomas Nelson.
Longman, Tremper (2001). Song of Songs. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
Steinberg, Julius (2014). Das Hohelied. Witten: SCM R.Brockhaus.