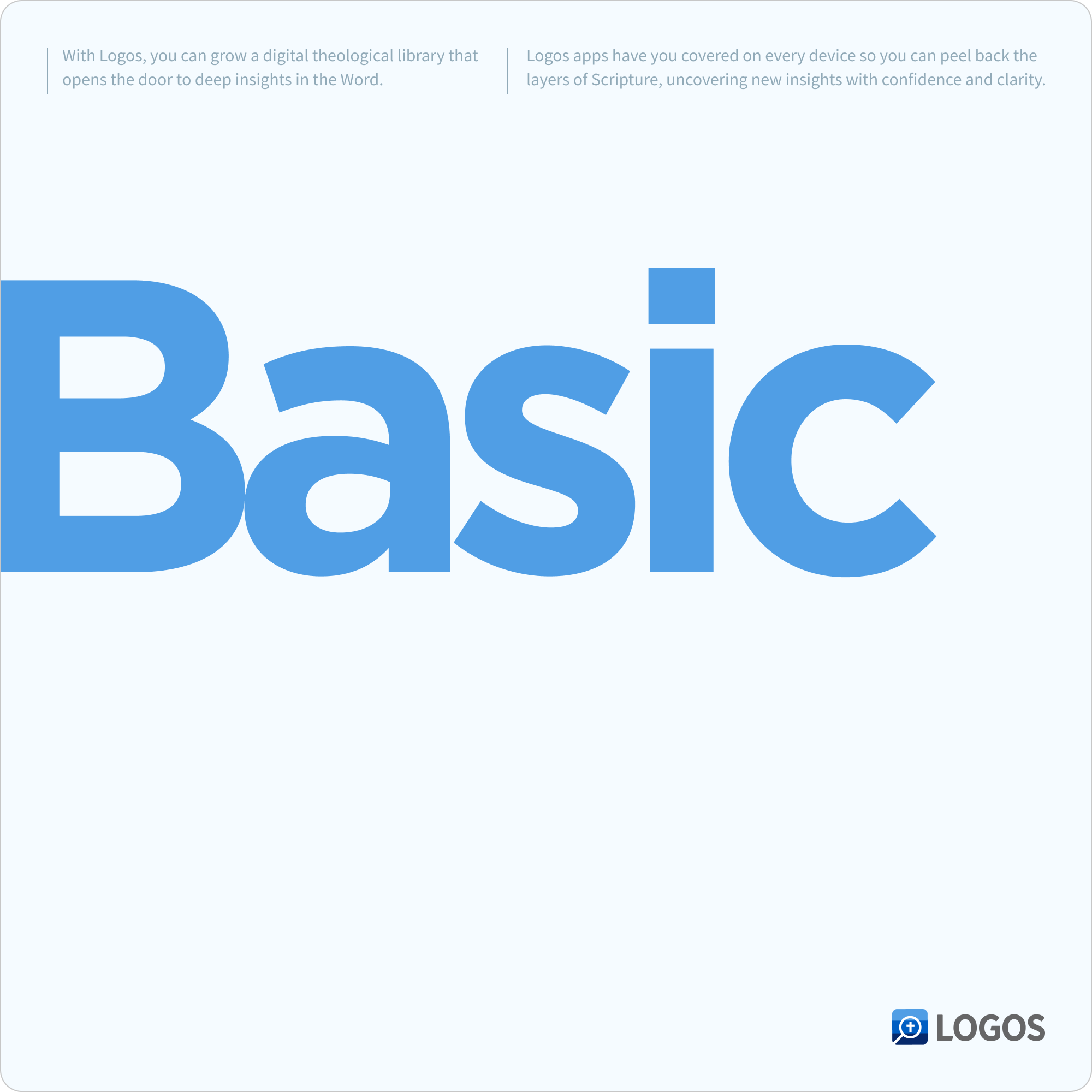Inhalt
Mehr Verständnis von der gewaltigsten Rede aller Zeiten
Die Bergpredigt ist bekannt für den hohen ethischen Maßstab, den Jesus an seine Jünger legt. Jesus beginnt die Bergpredigt allerdings nicht mit Ansprüchen. Er beginnt mit Zusprüchen, den sogenannten Seligpreisungen (oder auch Makarismen). Dieser Beitrag ist der dritte Teil einer Wortstudie, die zeigen soll, was es mit diesen Zusprüchen Jesu auf sich hat. Gleichzeitig soll dies eine Anleitung sein, selbstständig Wortstudien mit Logos durchzuführen.
Der Beitrag orientiert sich an den vier Schritten für eine Wortstudie aus dem neu erschienenen Buch How to Understand and Apply the New Testament von Andrew David Naselli. Die vier Schritte lauten:
- Wähle ein griechisches Wort für eine Wortstudie aus.
- Analysiere sein Bedeutungsspektrum im Neuen Testament.
- Vergleiche, wie das Wort in der Septuaginta und außerbiblischer Literatur verwendet wird.
- Ermittle die wahrscheinliche Bedeutung des Worts in Schlüsselstellen des Neuen Testaments.
Der erste Teil war den Schritten 1 und 2 gewidmet. Der zweite Teil des Beitrags widmete sich dem ersten Teil von Schritt 3, der Bedeutung von makarios in den kanonischen Schriften der Septuaginta. In diesem dritten und letzten Beitrag werden wir die Bedeutung von makarios in der außerbiblischen Literatur betrachten1 und uns für die wahrscheinlichste Bedeutung entscheiden.
Schritt 3: Vergleiche, wie das Wort in der außerbiblischen Literatur verwendet wird
Begriffsdefinitionen
Die LXX enthält nicht nur die (aus evangelischer Sicht) kanonischen Schriften des Alten Testaments, sondern auch apokryphe und pseudepigraphe Schriften. Nach evangelischem Verständnis sind die Apokryphen, vereinfacht ausgedrückt, jüdische Schriften, die in der zwischentestamentlichen Zeit entstanden, also nachdem der alttestamentliche Kanon abgeschlossen war (ca. 400 v. Chr.) und bevor die neutestamentlichen Schriften verfasst wurden.2 Dazu zählen z. B. Geschichtsbücher wie 1. und 2. Makkabäer oder Weisheitsbücher wie Sirach. Die Apokryphen enthalten auch Zusätze zu den alttestamentlichen Büchern Ester und Daniel. Die alttestamentlichen Pseudepigraphen sind jüdische Schriften außerhalb der kanonischen und apokryphen Schriften, die fälschlicherweise einer bekannten jüdischen Person zugeschrieben werden.3 Zu ihnen werden z. B. 3. und 4. Makkabäer, 3. und 4. Esra und die Psalmen Salomos gezählt.
Die Suche in Logos vorbereiten
Um die Vorkommen von makarios in den Apokryphen angezeigt zu bekommen, folgen Sie den Schritten, die im zweiten Beitrag angeführt sind, bis Sie die 68 Treffer in 66 Versen in der LXX angezeigt bekommen.
Im zweiten Beitrag hatten wir einen Weg aufgezeigt, wie wir uns mit Hilfe einer angelegten Versliste nur die Vorkommen in den kanonischen Schriften anzeigen lassen können. Das geht ganz ähnlich, wenn wir uns nur die Verse aus den Apokryphen oder Pseudepigraphen anzeigen lassen wollen.
- Klicken Sie auf den Menüpunkt Dokumente und dann auf Versliste.
- Benennen Sie die Versliste mit Apokryphen.
- Wählen Sie eine Bibelübersetzung mit Apokryphen aus, z. B. die Luther 1984.
- Geben Sie im Feld Bibelstelle ein, dass sie vom ersten (Judit) bis zum letzten Buch der Apokryphen (Das Gebet Manasses) alle mit einbeziehen wollen. Das geht bei Luther, da die Apokryphen hier alle zwischen dem AT und NT stehen: Judit-Gebet Manasses.
Nun haben wir die Liste für die Versliste für die Apokryphen erstellt. Eine Versliste für die Pseudepigraphen zu erstellen, ist nicht so einfach, da sie in keinem verfügbaren Werk aufeinanderfolgend enthalten sind. Deswegen verzichten wir hier darauf.
Makarios in den Apokryphen
Um die Vorkommen von makarios in den apokryphen Schriften angezeigt zu bekommen, legen wir den Suchbereich auf unsere Versliste Apokryphen fest und bekommen 15 Vorkommen angezeigt.
Die 15 Vorkommen von makarios verteilen sich auf die Bücher Tobias, Weisheit, Jesus Sirach und Baruch. 11 Vorkommen davon befinden sich allein im Buch Jesus Sirach. Jesus Sirach entstand vermutlich im zweiten Jahrhundert vor Christus und wird zur Weisheitsliteratur gezählt. Hier wird der Mensch makarios genannt, der weise und moralisch handelt (14,1f.20; 31,17; 34,8; 48,11; 50,28).4 Der Grund dafür, dass er makarios genannt wird, sind seine guten Lebensumstände (25,8f; 26,1; 28,19). So heißt es z. B. in 25,8: „Wohl dem, der eine verständige Frau hat! Wer mit seinen Reden nicht entgleist. Wer denen nicht diene n muss, die seiner nicht wert sind.“ Oder in 26,1: „Wohl dem, der eine gute Frau hat! Der lebt noch einmal so lange.“
Makarios in den Pseudepigraphen
Wenn wir uns noch einmal alle Vorkommen von makarios in der LXX anschauen und die kanonischen und die apokryphen Schriften außen vorlassen, finden wir makarios insgesamt 11 Mal in der LXX – Fünf Mal in 4.Makkabäer und in sechs Mal den Psalmen Salomos. Da diese pseudepigrahischen Bücher nicht in der Lutherübersetzung enthalten sind, ist kein deutscher Text verfügbar. Wer englisch versteht, kann sich aber mit „The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English“ von R. H. Charles abhelfen. In der ersten Spalte steht weiterhin der griechische Text der LXX, in der zweiten die englische Übersetzung der Verse aus den Apokryphen und in der dritten die englische Übersetzung der Verse aus den Pseudepigraphen.
- Makkabäer wird in etwa auf das Ende des ersten Jahrhunderts datiert. Wir blenden die Verse deshalb hier aus. Die Psalmen Salomos werden allerdings meistens auf das erste Jahrhundert v. Chr. datiert. Von daher ist es für uns von großem Interesse, wie die Schreiber des Buches makarios gebrauchten.
In den Psalmen Salomos sind die Personen, die als makarios bezeichnet werden (wie in Jesus Sirach) diejenigen, die gottesfürchtig (6,1) sind und ein moralisches Leben führen (4,23), ggf. auch durch erfahrene Zurechtweisung Gottes (10,1). Die Grund dafür, dass sie makarios genannt werden, liegt in der Rettung, die sie vom Herrn erfahren. Der Herr befreit sie von bösen Menschen (4,23; 6,1) und er versorgt sie (5,16). Die Rettung und Versorgung liegt dabei nicht in weiter Zukunft, sondern ist in der Gegenwart erfahrbar. Das wird besonders in den letzten beiden Vorkommen deutlich, wo sie Bezug auf die Wiederherstellung Israels nehmen (17,44; 18,6).
Zusammenfassung
Sowohl die Apokryphen als auch die Pseudepigraphen nennen die Menschen makarios, die sich durch ihre Gottesfurcht und ihren moralischen Charakter auszeichnen. Das haben wir am Beispiel von Jesus Sirach und den Psalmen Salomos aufgezeigt. Sie gelten als makarios wegen ihrer guten Lebensumstände und weil sie Gottes Hilfe in der Gegenwart erleben.
Schritt 4: Ermittle die wahrscheinliche Bedeutung des Worts
Wir haben die Bedeutung von makarios in den verschiedenen Teilen der Bibel und der außerbiblischen Literatur betrachtet. Im Alten Testament haben wir die besondere Rolle von makarios in der Weisheitsliteratur gesehen. Zentral ist Psalm 1, wo ein ganzheitliches Aufblühen des Gerechten mit makarios verbunden ist. In den Apokryphen und den Pseudepigraphen hingegen steht der diesseitige Segen stark im Zentrum, bis dahin, dass die Wiederherstellung Israels und die Ausrottung der Feinde im Blick sind. Im neuen Testament wird hingegen die eschatologische Spannung sichtbar. Im Kontext dieser eschatologischen Spannung lassen sich auch die Makarismen der Bergpredigt am besten einordnen. Sie heben sich stark von den Erwartungen der zwischentestamentlichen Schriften ab, indem sie die Menschen makarios nennen, die Leid tragen, nicht die, die (bereits jetzt) triumphieren. Jesus knüpft allerdings an das Verständnis der alttestamentlichen Weisheitsliteratur an.
Was ist nun die beste Übersetzung für makarios? Selig? Glückselig? Glücklich? Keiner dieser Begriffe spiegelt die Bedeutung von makarios in den Seligpreisungen perfekt wieder. So schreibt auch Luz in seinem Kommentar:5
„The translation ‚happy‘ sounds somewhat banal, and it obscures the eschatological character of the promises in the second clauses. The traditional interpretation as ‚blessed‘ is not only a ‚religious‘ term that is hardly in use any longer; it also evokes in a much too unilinear way associations with the beyond: in German ‚the blessed‘ is a common designation of the dead. However, these beatitudes are not designed to give comfort by making promises about the next life; they are an authoritative language act that pronounces people happy in the here and now. In short, there is no ideal translation in German [or English].“
Man wird in einer Predigt nicht darum herumkommen, den Begriff zu erklären. Wesentlich wird dabei sein (1) die eschatologische Spannung aufrechtzuerhalten – wie im NT, (2) sich von einem rein diesseitigen Glück zu distanzieren – entgegen der Tendenz der zwischentestamentlichen Schriften und (3) das ganzheitliche Aufblühen aus Psalm 1 im Blick zu haben.
1. Logos bietet auch die Möglichkeit, in den Kirchenvätern und anderen Quellen zu suchen. Um nicht auszuufern, beschränken wir uns hier aber auf die vorchristliche Literatur. ↩
2. Die Begriffsdefinitionen sind je nach Kirche unterschiedlich und die Datierung der einzelnen Bücher ist häufig umstritten. Wir verwenden der Einfachheit halber aber diese Definitionen. ↩
3. Letzteres kann natürlich auch auf apokryphe Schriften zutreffen. ↩
4. Die Verszählung der hier verwendeten Version der LXX und der deutschen Übersetzungen (Luther 1984) weichen teilweise voneinander ab. Die Versangabe bezieht sich hier immer auf die LXX von Rahlfs. ↩
5. https://www.logos.com/product/50219/hermeneia-matthew‑1–7‑a-commentary-on-matthew‑1–7 ↩