Das Evangelium hat lebensverändernde Kraft. Das ist breiter christlicher Konsens. Aber wie kommt diese Veränderung im Leben und Wesen eines Menschen zustande? Schon seit Beginn der christlichen Kirche treibt diese Frage Christen aller Generationen immer wieder um. Denn hier kommt die Theologie sprichwörtlich auf die Straße. Hier wird sie konkret, lebbar und sichtbar.
Auch für andere Religionen und die Philosophie war diese Frage durch die Jahrtausende relevant und wurde vielfach bearbeitet. Wie wird ein Mensch tugendhaft? Wo liegt die Quelle für charakterliche Veränderung? Liegt sie im Menschen und muss nur hervorgeholt werden? Oder braucht es einen Einfluss von außen?
Inhalt
Luther oder Aristoteles? – Ein alter Streit
In der Reformation des 16. Jahrhunderts begegnen sich dann zwei dieser Vorstellungen in scharfem Kontrast – mit Auswirkungen bis in die Theologie der Gegenwart.
Da ist zunächst Aristoteles: Er glaubt, dass ein Mensch Tugend (eigentlich Vortrefflichkeit – gr. ἀρετή) durch Übung erwerben kann. So wie ein Mensch durch viel Üben am Instrument ein Musiker wird. Hier führt das Tun zum Wesen. Diese Idee hatte dann in der christlichen Theologie des Mittelalters großen Einfluss.
Nun wurde dieser Konsens von einem jungen, kämpferischen Mönch herausgefordert. In seiner „Disputatio contra scholasticam theologiam“ von 1517 macht Luther schon sehr früh die Schärfe dieses Konflikts besonders deutlich:
42. Nicht indem wir gerecht handeln, werden wir gerecht, sondern [indem wir] gerecht geworden [sind], handeln wir gerecht. Gegen die Philosophen.
43. Fast die ganze Ethik des Aristoteles ist sehr schlecht und der Gnade feind. Gegen die Scholastiker.
[…]45. Es ist ein Irrtum zu sagen, ohne Aristoteles wird man kein Theologe. Gegen die allgemeine Rede.
46. Vielmehr wird man ein Theologe nur, wenn man es ohne Aristoteles wird.
Übersetzung aus: Der Mensch vor Gott: Deutsche Texte (Bd. 1, S. 25). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Erhältlich bei Logos.
Luthers Gegenentwurf
Schon ein Jahr später legt Luther in Heidelberg seinen Gegenentwurf detaillierter dar (These 25):
XXV. NICHT DER IST GERECHT, DER VIEL WIRKT, SONDERN DER OHNE WERK VIEL AN CHRISTUS GLAUBT.
Denn die Gerechtigkeit Gottes wird nicht erworben aus häufig wiederholten Handlungen, wie Aristoteles gelehrt hat, sondern sie wird eingegossen durch den Glauben. „Der Gerechte lebt nämlich aus dem Glauben“, Röm 1 und 10. „Mit dem Herzen wird zur Gerechtigkeit geglaubt.“ Von daher will ich jenes (,ohne Werk‘) so verstanden wissen: nicht, dass der Gerechte nichts wirke, sondern dass seine Werke nicht seine Gerechtigkeit bewirken, sondern vielmehr seine Gerechtigkeit die Werke bewirkt. Denn ohne unser Werk werden die Gnade und der Glaube eingegossen, und wenn sie eingegossen sind, folgen schon die Werke.
Übersetzung aus: Der Mensch vor Gott: Deutsche Texte (Bd. 1, S. 57–59). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
Erhältlich bei Logos.
Luther öffnet damit einen Streit zwischen zwei Extrempunkten: aktiver Erwerb gegen passiven Empfang. Übung gegen Geschenk. Eigene Gerechtigkeit gegen fremde Gerechtigkeit. Tugend gegen Heiligung.
Aber ist dieser Gegensatz wirklich so scharf? Ist Luther der Gute und Aristoteles der Böse?
In diesem ersten Artikel gehe ich der Frage nach: Wie wurde dieses Thema in der Kirchengeschichte aus christlicher Sicht bewertet? Der zweite Artikel beleuchtet einige Anfragen an beide Konzepte aus biblischer und theologischer Sicht. Im letzten Artikel dieser Serie stelle ich beide Seiten einem Entwurf eines späteren evangelischen Theologen – Adolf Schlatter – gegenüber und versuche aus seiner Position heraus ein Fazit zu finden.
Zwei Linien der Kirchengeschichte
Der Streit um die Tugend bzw. Heiligung ist alt und er beschränkt sich bei weitem nicht auf Luthers Auseinandersetzung mit Aristoteles. Im Folgenden überfliege ich exemplarisch die christliche Theologiegeschichte und versuche die Konfliktlinien in breiten Strichen nachzuzeichnen.
Die „aristotelische“ Linie
Aristoteles ist sicher gemeinsam mit Platon der einflussreichste Denker westlicher Philosophie. Kein Wunder, dass seine Gedanken auch die christliche Theologie und Ethik beeinflusst haben. Die einschlägige Stelle zum Tugenderwerb, gegen die sich Luther wendet, ist:
Die Tugenden dagegen erwerben wir, indem wir sie zuerst ausüben, wie es auch für die sonstigen Fertigkeiten gilt. Denn was wir durch Lernen zu tun fähig werden sollen, das lernen wir eben, indem wir es tun: durch Bauen werden wir Baumeister und durch Kitharaspielen Kitharisten. Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln, besonnen durch besonnenes, tapfer durch tapferes
Handeln. (Aristoteles/Rainer Nickel (Hrsg.), Nikomachische Ethik. Berlin:Walter de Gruyter 2014, 57 (1103 b))
Die Tugend (ἀρετή) ist dabei der zentrale Begriff der klassisch griechischen Ethik und bedeutet lobenswerte Charaktereigenschaft. In der Alten Kirche vertraten Cassianus und Gregor I. eine Position, die der klassisch griechischen in Teilen ähnelt: Zur Korrektur der sieben Todsünden seien christliche Tugenden notwendig, die durch Übung erworben werden könnten. Petrus Abaelard (1079–1142) als Vertreter der Frühscholastik lehnt sich in seinem Tugendbegriff ebenfalls stark an Aristoteles an.
Der Entwicklung folgend gelangen wir zu Thomas von Aquin als Vertreter der Hochscholastik: Obwohl Thomas häufig als der Inbegriff der Synthese aus Aristoteles und Christentum gilt, folgt er Aristoteles bei der Tugend nur zum Teil. Zwar gibt es nach thomistischer Lehre sog. erworbene Tugenden (virtuis acquisitis), analog zur aristotelischen Sicht. Bei der heilsnotwendigen Kategorie der eingegossenen Tugenden (virtuis infusis) jedoch widerspricht er Aristoteles. Mehr dazu im folgenden Abschnitt. In nachreformatorischer Zeit tauchen Aspekte des aristotelischen Gedankens bei F.D.E. Schleiermacher wieder auf.
Die „reformatorische“ Linie
Für die frühen Kirchenväter (bspw. Clemens romanus) sowie die sog. ante- und postnicänischen Väter (z. B. Irenäus, Tertullian) ist die Heiligung ein zentraler Begriff. Dieser hat seine Wurzeln aber vor allem im Alten Testament und nicht in der griechischen Philosophie. Die Heiligung als Gabe Gottes manifestiert sich für sie in den Sakramenten.
Die Bedeutung von Augustinus
Die Wurzeln der reformatorischen Lehre von der Heiligung finden sich dann ohne Zweifel bei Augustinus schon ausdrücklich, der sowohl für Luther als auch für Calvin maßgeblicher Einfluss ist. Ähnlich wie die Platoniker sieht Augustinus die Tugenden als Ausdruck eines höchsten Gutes, nämlich der Liebe. Diese Liebe als Wurzel der Tugend ist eingegossen durch den Heiligen Geist (Röm 5,5) und kann daher nur von außen, von Gott kommen. Ohne die Ausrichtung auf Gott durch die gottgegebene Liebe kann es keine wahre Tugend geben: „Denn die wahre Tugend strebt als Ziel an jenes Gut des Menschen, das von keinem anderen übertroffen wird“ (de Civitate Dei V, XII, 4).
Seine Ansicht der Tugend als etwas, dass nur Gott in uns ohne uns bewirkt, findet sich in zahllosen späteren Autoren wieder (Petrus Lombardus, Thomas und bei den Reformatoren). Dies belegt die starke Strahlkraft der augustinischen Tugendlehre in der christlichen Theologie.
Lombardus vs. Abaelard
Im Mittelalter bindet Petrus Lombardus – gegen seinen Zeitgenossen Abaelard – die Tugenden eng an die Gnadengaben Gottes im Heiligen Geist. Sie ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes. Thomas hat – wie oben gesehen – ein Konzept in dem gewisse Tugenden durch Übung erworben werden können, er folgt aber Augustin in der Hinsicht, dass die heilsnotwendigen Tugenden eingegossen werden (virtuis infusis). „Die Ursache, welche die eingegossene Tugend […] bewirkt, ist Gott. Dies ist ausgedrückt in den Worten: welche Gott in uns ohne uns wirkt.“ (Summa Theologica I‑II, Q55, 4)
Luther vermeidet dann den Begriff Tugend weitgehend, weil er sich von Aristoteles und der Philosophie abgrenzen will. Er redet stattdessen von der transformierenden Kraft der Gnadengaben Gottes. Der Prozess der Heiligung folgt „automatisch“ auf die Rechtfertigung. So entwickelt sich der Charakter des Christen von der neuen Realität in Christus her. Der Glaube an Christus tritt aus dem Inneren des Menschen hervor in seine Handlungen (iustitia actualis).
Auch Johannes Calvin lehrt, dass „all solche Tugenden […] Gottes Gaben sind“. Für ihn sind sogar die Tugenden (er nennt sie „Tugendabbilder“) der Ungläubigen Geschenke Gottes. Ohne den Glauben sind sie jedoch verdorben und letztendlich vor Gott keine Tugend mehr.
Zwischenfazit
Ist nun die lebensverändernde Wirkung des Evangeliums nur eine Gabe Gottes oder habe ich als Christ auch etwas damit zu tun? Kann ich „an mir arbeiten“?
Die Christen, die uns in 2000 Jahren vorangegangen sind, decken ein weites Spektrum ab und jede Zeit scheint etwas mehr in die eine oder in die andere Richtung zu tendieren. Ist diese Frage deshalb eine „ewige Streitfrage“, die wir endlich mal auf sich beruhen lassen sollen?
Gerade weil sie in jeder Generation neu diskutiert wird, zeigt sich aus meiner Sicht ihre große Relevanz. Es geht schließlich um die praktische Auswirkung des Glaubens im Leben.




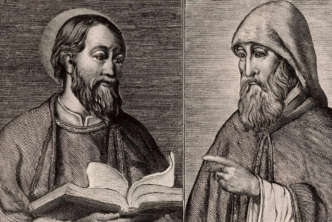


[…] vorangegangenen Artikel habe ich die großen Denklinien der Kirchengeschichte in der Frage nach Tugend und Heiligung […]
Die Frage scheint mir yu sein, wie weit ich mich von Gott beschenken lasse, oder wie weit ich meine, dass ich Gott nicht brauche, weil ich selber stark genug bin.
[…] nach dem Wie der christlichen Lebensveränderung nachgegangen. Zunächst in einer historischen Betrachtung der verschiedenen Denkwege und anschließend in der Erwägung von Bibeltext und […]