„Verzeih, oder sonst kannst du etwas erleben!“ Ist diese Auslegung des Gleichnisses vom unbarmherzigen Knecht zulässig? Lesen Sie in 20 Min., welche 8 Aspekte bei der Auslegung des Gleichnisses beachtet werden sollten.
Inhalt
- Die traditionelle Auslegung des Gleichnisses
- Der Aufbau des Textes
- Aspekt 1: Der Kontext des Gleichnisses
- Aspekt 2: Es geht um das Königreich Gottes
- Aspekt 3: Die Summe der Schuld im Gleichnis
- Aspekt 4: Der Job des Knechts
- Aspekt 5: Der Fehler des Knechts
- Aspekt 6: Der Mitknecht
- Aspekt 7: Ist Gott wie der König im Gleichnis?
- Aspekt 8: Die Strafe
- Fazit
- Bibliografie
Die traditionelle Auslegung des Gleichnisses
Üblicherweise wird das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht als eine direkte Lektion über die Notwendigkeit der Bereitschaft zur Vergebung gepredigt und dementsprechend wie folgt ausgelegt:
Gott vergibt eine Schuld, die größer ist als das, was jemand jemals zurückzahlen könnte. Die Empfänger eines solchen Gnadengeschenks müssen ebenfalls ihren Schuldnern verzeihen oder sie werden ewiger Folter übergeben.
Ist dies eine zulässige Auslegung des Textes? In diesem Artikel werde ich 8 Aspekte des Gleichnisses ansprechen, die bei der Auslegung nicht übersehen werden sollten.
Der Aufbau des Textes
Der Bibeltext (Mt 18,21–35) besteht aus drei Teilen:
- Das Gespräch zwischen Jesus und Petrus (Mt 18,21–22), welches als Einleitung dient (orange markiert).
- Das Gleichnis (Mt 18,23–34) (gelb markiert).
- Ein erklärendes Fazit (Mt 18,35) (grün markiert).
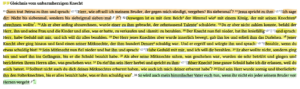
Aspekt 1: Der Kontext des Gleichnisses
Eine Grundregel der Hermeneutik ist: Bibelstellen müssen in ihrem Kontext verstanden werden. Was ist der Kontext dieses Gleichnisses?
Jesus lehrte seine Jünger (Mt 18,1). Das Thema von Matthäus 18 sind Anweisungen Jesu, wie die Jünger Gemeinschaft miteinander leben sollen.
Jesus begann mit der Notwendigkeit von Demut (Mt 18,1–5): Wer sich selbst erniedrigt, ist der Größte im Himmelreich. Dann ermahnte er seine Jünger, andere nicht zur Sünde zu verführen (Mt 18,6–10) und betonte, dass er gekommen ist, um das Verlorene zu retten (Mt 18,11). Er sprach darüber, wie wichtig ihm jeder Mensch ist und dass er deshalb nicht will, dass eines seiner Schafe verloren geht (Mt 18,12–14).
Als Nächstes gab er seinen Jüngern Richtlinien, um Sünde liebevoll anzusprechen und dadurch den Sünder zur Buße zu bringen (Mt 18,15–20). Denn echte Liebe kehrt Sünde nicht unter den Teppich, sondern spricht Sünde an, aber nicht um zu verdammen, vielmehr um den Sünder vor den zerstörerischen Konsequenzen der Sünde zu bewahren.
Der direkte Kontext des Gleichnisses (Mt 18,21–22)
Das Kapitel 18 endet mit einem Teil, der die Wichtigkeit von Vergebung in den Fokus rückt. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht findet sich nur bei Matthäus und wird von einer Frage des Petrus eingeleitet (Mt 18,21 Luther):
Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist’s genug siebenmal?
Diese Frage und Jesu Antwort sind der Kontext des Gleichnisses und damit der hermeneutische Schlüssel zur rechten Auslegung. Deshalb müssen wir zuerst Jesu Antwort verstehen, bevor wir zu dem Gleichnis kommen können. Jesus antwortete (Mt 18,22 NGÜ):
»Nein«, gab Jesus ihm zur Antwort, »nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal!«
Die Antwort Jesu spielt auf eine alttestamentliche Szene an: das Lamech-Lied (Gnilka:145; Fiedler:307). In Genesis 4,15 droht Gott eine siebenfache Strafe dem an, der Kain erschlägt. Lamech aber verlangt siebenundsiebzigfache Rache, sollte er erschlagen werden (Genesis 4,24 ELB):
Wenn Kain siebenfach gerächt wird, so Lamech siebenundsiebzigfach.
Hier ist die Rede von einer Eskalation der Rache. Lamech will, dass unzählige Menschen getötet werden, um seinen Tod zu rächen. Bezeichnenderweise ist er der 6. nach Kain und der 7. nach Adam, wurde aber mit Kain vom Stammbaum Adams verworfen. Parallel dazu ist der 7. nach Adam in der Linie von Seth ein Mann namens Henoch. Dieser wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen (Gen. 5,24). Hier zeigt sich die erste Typologie von Antichrist (Lamech) und Christus (Henoch) im Alten Testament. Bereits im vierten Kapitel der Bibel wird die Tendenz des menschlichen Herzens offenbar: Es will Rache. Jesus greift diese alttestamentliche Szene auf und, wie er es so oft tut, kehrt sie um. Er verkehrt sie in eine Eskalation der Gnade.
Jesus will, dass seine Jünger „70 mal 7“ (Strack & Billerbeck:797) vergeben. Damit meint er sicher nicht, dass wir mitzählen und nach dem 490ten mal sagen: „Das war’s. Jetzt muss ich dir nicht mehr vergeben.“ Wer zählt, hat nicht wirklich vergeben. Jesus untersagt Petrus das Zählen (Schlatter:240).
Der Zielpunkt Jesu ist eindeutig. Er will unbegrenzte Vergebung (Maier:154).
Das „Deswegen“ (ELB) in Vers 23 verbindet das Gleichnis mit den zwei einleitenden Versen. Jesus fordert unbegrenzte Vergebung von seinen Jüngern, das ist der Kontext des Gleichnisses. Mit dieser Grundlage im Kopf können wir nun das Gleichnis anschauen.
Aspekt 2: Es geht um das Königreich Gottes
Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König… (Mt 18,23 ELB)
Dieser einleitende Satz macht klar, worum es in dem Gleichnis geht: Es geht um das Königreich Gottes. Jesus will mit dem Gleichnis eine Lektion lehren darüber, wie sein Reich funktioniert. Mit anderen Worten: Es geht darum, wie die Dinge innerhalb des Herrschaftsbereichs Gottes und damit analog auch innerhalb der Gemeinschaft Jesu funktionieren und ablaufen sollten. Jesu Aufforderung zur Vergebung richtet sich also primär an seine Jünger, die anderen Geschwistern vergeben sollen (siehe Aspekt 6), deshalb ist in V.35 (Schlachter) auch die Rede vom Bruder:
wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt.
Aspekt 3: Die Summe der Schuld im Gleichnis
Die Schuldsumme zehntausend Talente sprengt alle normalen Vorstellungen. Heinz Schröder berechnet sie auf 100 Millionen Denare, wobei 1 Denar dem Tageslohn eines Arbeiters entspricht. Zum Vergleich: Der jährliche Steuerertrag für die Söhne des Herodes (Archelaus, Antipas, Philippus) belief sich auf neunhundert Talente; der Tempelschatz betrug nach 2 Makk 5,21 eintausendachthundert Talente (Maier:155).
Der Knecht hätte, bei einem üblichen Tageslohn von einem Denar, mehr als 270.000 Jahre arbeiten müssen, um seine Schuld abbezahlen zu können. Kein Knecht damals hatte die Chance, jemals eine solche riesige Summe anvertraut zu bekommen und entsprechend verlieren zu können. Es war vermutlich mehr Geld, als damals im gesamten Land existierte (Witherington:353–354).
Diese unrealistische gigantische Summe deutet bereits darauf hin, dass es sich hier bei diesem Gleichnis um ein überspitztes Beispiel handelt, bei dem nicht jedes Detail wörtlich zu nehmen ist, sondern bei dem es um die groben Züge der Geschichte geht.
Aspekt 4: Der Job des Knechts
Der Knecht (griechisch: doulos) war vermutlich ein Sklave, der als so eine Art hoher Beamter gedient hat, ähnlich wie Josef als Verwalter im Haus des Potifar gedient hat. Er stand wahrscheinlich im Dienst des Königs und verwaltete Geld für den König oder war eine Art Steuerbeamter, der für die Eintreibung der Steuern zuständig war (Snodgrass:68). Nur so ist eine solch große Schuldensumme ansatzweise denkbar.
Dieser Punkt ist bedeutend, wenn überlegt wird, um welche Art an Schuld es sich im Gleichnis handelt. Hier ist eine Parallele zu Genesis 1–2 denkbar. Gott hat die Menschen als seine Verwalter dieser Erde eingesetzt. Er will durch uns regieren. Er ist ein Gott, der gerne in Partnerschaft arbeitet. Als Christen sollten wir uns fragen, ob wir diese Welt, Gottes Schöpfung, in seinem Sinne verwalten.
Aspekt 5: Der Fehler des Knechts
Als der vergebene Knecht eiskalt seinen Schuldner, wegen seiner geringen Schuld, ins Gefängnis schmeißen lässt, merkt jeder Leser, dass dies zutiefst widernatürlich ist. „Das kann der doch nicht machen“ oder ähnliche Gedanken kommen beim Lesen dieses Verses (V.30) auf. Dieses Schock-Element im Gleichnis deutet darauf hin, dass es hier um die Pointe des Gleichnisses geht.
Die unermessliche Barmherzigkeit des Königs hätte den Knecht barmherzig machen müssen, aber sein hartherziges Verhalten zeigt, dass er die Barmherzigkeit des Königs nicht verstanden hat.
Jesus kam, um ein Gnadenjahr zu verkünden (Lukas 4,19). Er stellte Barmherzigkeit, Vergebung und Feindesliebe in das Zentrum seiner Lehre. Jesus predigte einen Gott voller skandalöser Güte, der unverdient Vergebung gewährt. Diesen Ruf zur radikalen Vergebung und selbstlosen Liebe predigte er nicht nur, sondern demonstrierte beides durch sein eigenes Leben.
Diese Barmherzigkeit Gottes, die Jesus durch sein Leben modellierte, forderte er auch von seinen Jüngern (Lukas 6,36 ELB):
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Jesu Weg ist der Weg der Feindesliebe, der Vergebung und der selbstlosen Liebe. Jünger Jesu zu sein bedeutet, diesem Weg Jesu zu folgen. Wer die Barmherzigkeit Gottes erkennt, der wird barmherzig. Genau darauf spielt Jesus in Vers 33 (EÜ) an:
Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?
Barmherzigkeit wurde nicht wahrhaftig empfangen, wenn sie nicht auch erwiesen wird, denn die Barmherzigkeit Gottes verändert. Wenn die Barmherzigkeit Gottes nicht das Herz verändert, dann wurde sie nicht verstanden und angenommen. Auch wenn dieser einprägsame Satz sicherlich nicht allgemeingültig ist, enthält er doch einiges an Wahrheit:
Forgiveness not shown is forgiveness not known (Vergebung, die nicht gezeigt wird, ist Vergebung, die nicht verstanden wurde.) (Snodgrass:75).
Aspekt 6: Der Mitknecht
Der Mitknecht bittet den Schuldner um Geduld. Er will seine (vergleichsweise kleine) Schuld abbezahlen. Hier geht es um eine Person, die reumütig ist und Dinge wieder in Ordnung bringen will, aber es aktuell nicht kann.
Der Kontext des Kapitels ist der Umgang von Jüngern Jesu untereinander (siehe Aspekt 2). Damit geht es in dem Gleichnis primär um Jünger Jesu, die die gewaltige Vergebung Gottes erfahren haben, aber nicht bereit sind, ihren Geschwistern zu verzeihen, selbst wenn diese ernsthaft um Verzeihung bitten.
Dass das Gleichnis auch für Nichtgläubige als Warnung dienen soll, auf die Gnade Gottes zu reagieren, ist sicher richtig, aber das ist nicht das primäre Thema dieses Gleichnisses.
Aspekt 7: Ist Gott wie der König im Gleichnis?
Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten (Mt 18,34 ELB).
„Und jeder, der nicht verzeiht, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Gott wird jeden, der nicht bereit ist zu vergeben, ewiglich den Folterknechten in der Hölle übergeben.“ So oder ähnlich kann man Vers 34 von manchen Kanzeln hören. Das Gleichnis wird auf die Moral minimiert: Verzeih, oder sonst kannst du etwas erleben! Diese Auslegung basiert vorwiegend auf Mt 18,35, wo es ja spezifisch heißt, dass der himmlische Vater so handeln wird wie der König.
Wie bereits erwähnt, der Kontext des Gleichnisses muss beachtet werden. Die einleitende Botschaft ist Jesu Aufruf zur unbegrenzten Vergebung. Hier im Gleichnis wirkt es aber eher so, als würde Gott einmal eine gigantische Schuld vergeben, wer dann jedoch nicht spornt und verzeiht, der kann sich auf etwas gefasst machen.
Ist das so gemeint? Fordert Jesus von seinen Jüngern unbegrenzte Vergebung, aber predigt einen Gott, dessen Gnade zu einem Ende kommt, wenn wir unseren Geschwistern nicht vergeben?
Zählt das große Bild oder jedes Detail?
Diese Gedanken führen zu einer fundamental wichtigen Regel der Gleichnis-Auslegung. Gleichnisse sind auf der Realität aufgebaut, die sie abbilden wollen. Das bedeutet, dass nicht jedes Detail des Gleichnisses eine Wahrheit vermitteln soll, sondern das Gesamtbild des Gleichnisses soll eine wichtige Botschaft kommunizieren (Snodgrass:68).
Dieses Gleichnis wird in groben und übertriebenen Zügen erzählt. Es handelt sich um ein absichtlich übertriebenes Szenario, welches die Aussage Jesu gegenüber Petrus über unbegrenzte Vergebung verdeutlichen soll. Problematisch wird es, wenn wir diese einfache Geschichte mit ihren breit gemalten Konturen nehmen und beginnen, jedes winzige Detail zu durchforsten wie ein Anwalt, der das Kleingedruckte liest.
Es ist gefährlich, Gleichnisse so zu lesen, als ob sie Gleichungen wären, als ob jeder Teil des Gleichnisses ein Spiegel der Wirklichkeit ist. Gleichnisse sind keine Gleichungen, und deshalb geht es bei der Auslegung von Gleichnissen auch nicht darum, Entsprechungen aufzulisten oder darum, jedes Echo einer Theologie aufzuspüren.
Fee & Stuart erklären, dass die meisten Gleichnisse Witzen ähneln (:182). Ein Witz hat eine Pointe, und wer die Pointe versteht, versteht auch den Witz. So ist es auch mit den Gleichnissen. Viele Gleichnisse hatten eine Pointe, und wer die Pointe verstand, verstand auch die Bedeutung des Gleichnisses. Wer versucht, jedes Detail eines Gleichnisses geistlich zu deuten, kann dabei die Pointe des Gleichnisses verpassen.
Die Pointe in diesem Gleichnis, welche klar wird durch das schockierende Element, ist die Unbarmherzigkeit des Schuldners im Lichte der Barmherzigkeit, die er erfahren hat. Darum geht es. Solch ein Verhalten passt nicht in das Königreich Jesu.
Wie können wir unterscheiden, welche Teile eines Gleichnisses übertragbar sind und welche nicht?
Bei Gleichnissen gibt es immer Teile, die übertragen werden können und Teile, die nie dafür gedacht waren. Die Beurteilung, welche Teile eines Gleichnisses übertragbar sind und welche nicht, kann nur gelingen mit einem Blick auf den Kontext der gesamten Bibel.
Es ist gut, die Bibel mithilfe der Bibel auszulegen. Welche Gleichnis-Teile stimmen damit überein, was woanders in der Bibel offenbart wurde. Und welche Teile sind unvereinbar mit dem direkten Kontext der jeweiligen Stelle oder anderen Versen in der Bibel.
Ist Gott nun genauso wie der König in dem Gleichnis oder nicht?
Ja und nein.
Ja, Gott verzeiht genauso großzügig wie der König. Ja, Gott lässt Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort haben, sondern er wird für Gerechtigkeit sorgen. Ja, wenn wir nicht vergeben, dann wird das Konsequenzen haben (siehe Aspekt 8).
Nein, Gott bestraft Kinder (Mt 18,25) nicht für die Schuld ihrer Väter (Hes 18,20). Nein, Gott weiß bereits alles, was es zu wissen gibt und benötigt niemanden, der ihm neue Informationen zuspielt (Mt 18,29). Nein, ich denke nicht, dass Gott eine Folterkammer hat, in der er Christen foltern lässt, die nicht vergeben haben (Mt 18,34).
Aspekt 8: Die Strafe
Der eine oder andere hat vielleicht jetzt bei meinem letzten Satz geschluckt. Widerspricht Vers 35 nicht genau dieser Aussage?
Auf den ersten Blick scheint Vers 35 genau das zu bestätigen, dass Gott jeden, der nicht bereit ist zu vergeben, ewiglich den Folterknechten übergibt:
So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt.
Der Abschnitt (Mt 18,21–35) endet mit diesem erklärenden Kommentar, welches, laut einigen Theologen, eventuell von Matthäus ergänzt wurde. Die entscheidende Frage ist, was genau mit diesem Vers gemeint ist!
Zuerst ist es wichtig, diese eindringliche Warnung Jesu ernst zu nehmen. Erstaunliche Vergebung bringt auch große Verantwortung mit sich. Das Gleichnis macht klar, dass fehlende Bereitschaft zur Vergebung dramatische Konsequenzen haben wird. Aber was sind diese Konsequenzen?
Ist damit gemeint, dass Gott alle ewig in der Hölle foltern lassen wird, die nicht bereit sind zu vergeben? Aus folgenden zwei Gründen, würde ich vorschlagen, dass dieses Detail (die Folterknechte) des Gleichnisses nicht eins zu eins übertragen werden sollte.
1) Der Kontext des Gleichnisses
Der Kontext ist Jesu Aufforderung an seine Jünger, ihren Geschwistern zu vergeben. Wenn die angedeutete Strafe tatsächlich ewige Folter ist, dann würde das bedeuten, dass Christen, die ihren Geschwistern nicht vergeben, ihre Erlösung verlieren. Ob dies mit der biblischen Lehre vereinbar ist, sprengt den Rahmen dieses Artikels und muss wohl jeder für sich selbst prüfen. Im Grunde wird die neue Natur mit der Bereitschaft zu vergeben, (da sie ja Vergebung empfangen hat,) mit dem Wesen der alten Natur (Unvergebenheit und ungerechtfertigter Zorn) bewusst von Jesus in einen Widerspruch gestellt. Es ist aber auch nicht das einzige Paradoxon, was in der Schrift existiert und fordert uns zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott auf.
2) Die Strafe ist begrenzt und nicht ewig
Ein weiteres wichtiges Detail für die Auslegung findet sich im zweiten Teil von Vers 34 (ELB):
Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war.
Die Strafe ist im Gleichnis nicht ewig. Die Strafe ist zeitlich begrenzt: bis alles abbezahlt ist (was zugegeben eine lange Weile dauern kann). Dieses Detail ist wichtig. Dieser kleine Nebensatz deutet an, dass es hier nicht um ewige Folter in der Hölle geht.
Dieser Teil des Gleichnisses ist der Grund, weshalb manche katholische Theologen dieses Gleichnis als biblische Grundlage für das Fegefeuer verstehen. Sie sehen diese zeitlich begrenzte Strafe als eine reale und schmerzhafte Zeit der Reinigung und Bestrafung, bis „der Preis bezahlt“ ist und das Recht wiederhergestellt ist.
Wenn Vers 34 nicht wörtlich zu verstehen ist, wie kann Vers 35 dann verstanden werden?
Manchmal sind die Elemente eines Gleichnisses nicht nur dazu da, die Zuhörer zur Wahrheit zu überreden, sondern vielmehr, um sie zur Wahrheit zu schockieren, und das ist hier der Fall. Das Anliegen der Geschichte ist ein zweifaches: die Notwendigkeit von Barmherzigkeit und Vergebung und die Schwere jedes Versäumnisses, Barmherzigkeit und Vergebung zu zeigen (Snodgrass:73).
Dass der Mann den Folterern ausgeliefert wird, bis alles bezahlt ist, passt zum natürlichen Verlauf der Geschichte im damaligen kulturellen Kontext. Dieser Ausgang der Geschichte war, was die Zuhörer von einem damaligen König erwartet hätten.
Die eindringliche Sprache betont die Schwere der unterlassenen Barmherzigkeit und die Realität des Gerichts, sollte aber nicht wörtlich verstanden werden. Gott hat keine Folterknechte, und dieses Gleichnis sollte nicht dazu gezwungen werden, Auskunft über das Wesen des Gerichts zu geben.
Auch wenn die Details der Strafe nicht übertragbar sind, bleibt doch der Grundsatz bestehen, dass die Verweigerung von Vergebung Konsequenzen haben wird (Mt 6,14; Jak 2,13).
Wie passt dies mit der unbegrenzten Vergebung Gottes zusammen?
Jesus ist das Lamm, das die Schuld der Welt weggetragen hat (Joh 1,29; 1 Joh 2,1–2). Er hat das Lösegeld für alle Menschen bezahlt (1 Tim 2,6). Das Schuldproblem ist von Gottes Seite aus gelöst. Er vergibt nicht nur einmal, nein, seine Vergebung steht uns immer zur Verfügung. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt er uns immer mit offenen Armen entgegen, wenn wir Buße tun und zu ihm umkehren.
Wer nicht verzeiht, disqualifiziert sich selbst vom Königreich Gottes. Gott lässt niemanden in sein Königreich, der nicht wahrlich Buße getan und Jesus zum Herrn gemacht hat. Das wäre wie einen Wolf in einen Schafstall zu lassen. Deshalb wird im Neuen Testament immer wieder betont, dass Sünder nicht ins Königreich kommen können (1 Kor 6,9–10; Gal 5,21).
In Römer 1,18–23 definiert Paulus den Zorn Gottes dreimal (Vers 24, 26, 28) als eine Auslieferung der Menschen an die Konsequenzen ihrer eigenen Wünsche und Taten. Gottes Vergebung ist unbegrenzt, aber er zwingt sich nicht auf, sondern übergibt (so wie der König den Schuldner dem Folterknecht übergab) die Menschen, die ihn und seinen Weg der Liebe und Vergebung ablehnen, ihrem eigenen zerstörerischen Schicksal.
Die irdische Konsequenz
Ungeklärte Beziehungen und Unvergebenheit führen zu Hass und Bitterkeit. Die Entscheidung nicht zu vergeben gleicht der Entscheidung, eine Flasche Gift zu trinken. Wer nicht verzeiht, wird leider allzu oft ein Gefangener von Bitterkeit und Hass. Dies bringt allzu oft unsagbares Leid über ganze Familien, Freundeskreise und Gemeinden. Genau davor warnt Jesus. Deshalb ist der Weg seines Königreichs der Weg der Vergebung und der Feindesliebe. Wer von der Unvergebenheit nicht loslässt, der ist sprichwörtlich ein Gefangener und beginnt demnach schon jetzt den Preis seiner Unvergebenheit zu bezahlen.
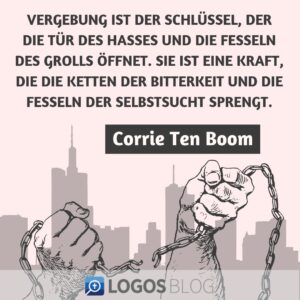
Eine eschatologische Konsequenz
Die Intensität der Sprache im Gleichnis deutet an, dass die angekündigte Strafe nicht nur eine irdische Seite hat, sondern ebenfalls eschatologische Konsequenzen hat. Wie diese (nicht ewige) Konsequenz für Gläubige, die ihren Glaubensgeschwistern nicht vergeben, aussieht, können wir nur vermuten. Es passt definitiv nicht zu ihrem neuen Wesen. Gott wird eines Tages für Recht sorgen und das wird schmerzhaft sein für alle, die sich weigern, das Unrecht zu korrigieren, das sie verursacht haben.
Fazit
Wer Gottes unfassbare Barmherzigkeit wahrlich erfahren hat, der wird natürlicherweise ebenfalls barmherzig sein und großzügig vergeben. Der Weg des Königreichs Gottes ist der Weg der Barmherzigkeit, welche in unbegrenzter Vergebung praktisch wird. Wer das Maß der erfahrenen Vergebung Gottes versteht, aber trotzdem diese Vergebung nicht den eigenen Schuldnern gewährt (besonders Glaubensgeschwistern), schadet sich selbst und disqualifiziert sich vom Reich Gottes.
Die Botschaft dieses Gleichnisses wird in unserer heutigen Zeit dringend benötigt, in der die Menschen auf ihre Rechte bestehen. Die Lehre des Gleichnisses widerspricht dem Zeitgeist, aber sie ist vielleicht der eindringlichste Ausdruck dafür, wie Christen leben sollten. Das christliche Leben – statt auf die eigenen Rechte zu bestehen – sollte ein ständiges Gewähren von Barmherzigkeit und Vergebung sein und dadurch Gottes eigenen Charakter widerspiegeln.
Wenn Ihnen beim Lesen eine Beziehung in den Kopf gekommen ist, in der noch Vergebung aussteht, dann nehmen Sie diesen Hinweis des Heiligen Geistes ernst und reagieren Sie auf die Worte Jesu. Jesus fordert seine Jünger auf, so barmherzig zu sein, wie auch der Vater barmherzig ist (Lukas 6,36). Wenn ich überlege, wie viel Gott mir vergeben hat, dann merke ich, wie viel auch ich Grund habe immer wieder zu vergeben. So ende ich mit den Worten von C.S. Lewis:
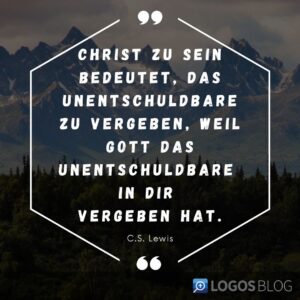
Bibliografie
Fee, GD. & Stuart, D. 2015. Effektives Bibelstudium: Die Bibel verstehen und auslegen. Gießen: Brunnen Verlag.
Fiedler, Peter. Das Matthäusevangelium. Herausgegeben von Ekkehard W. Stegemann u. a., Bd. 1, W. Kohlhammer GmbH, 2006.
Gnilka, Joachim. Das Matthäusevangelium. Herausgegeben von Joachim Gnilka und Lorenz Oberlinner, Sonderausgabe, Bd. 2, Herder, 1986–1988.
Maier, Gerhard. Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 15–28. Herausgegeben von Gerhard Maier u. a., SCM R. Brockhaus; Brunnen Verlag, 2017.
Schlatter, Adolf. Das Evangelium nach Matthäus: Ausgelegt für Bibelleser. Zweite Auflage, Bd. I, Evangelische Verlagsanstalt, 1954.
Snodgrass, Klyne. Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. Second Edition, William B. Eerdmans Publishing Company, 2018.
Strack, Hermann L., und Paul Billerbeck. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, 1922–1926.
Witherington, Ben, III. Matthew. Herausgegeben von P. Keith Gammons und R. Alan Culpepper, Smyth & Helwys Publishing, Incorporated, 2006.






Danke für den wertvollen Artikel.