Der barmherzige Samariter – jeder kennt dieses Gleichnis. Es hat unsere Kultur stark beeinflusst. Und trotzdem findet man darin immer wieder Neues und Überraschendes. Entdecken Sie in 18 Min. acht Aspekte, die bei der Auslegung des Gleichnisses oft übersehen werden.
Inhalt
- Eine alte Geschichte neu erzählt
- Der barmherzige Samariter – Eine Geschichte mit viel Einfluss
- Aspekt 1: Der Kontext
- Aspekt 2: Es geht um Leben und Tod
- Aspekt 3: Der Priester und der Levit
- Aspekt 4: Sünde der Passivität
- Aspekt 5: Ein Oxymoron
- Aspekt 6: Das Wirtshaus
- Aspekt 7: Die Kirchenväter
- Aspekt 8: Angemessene Hilfe
- Fazit
- Bibliografie
Eine alte Geschichte neu erzählt
Ein Liedermacher, den ich wirklich gerne höre, ist Uwe X. Seine Lieder schaffen es, gewohnte Geschichten und Situationen aus neuen Perspektiven zu erzählen und bringen mich dadurch ins Nachdenken. Sein Lied „Der Fremde“ erzählt das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25–37) auf eine frische Weise. Die Botschaft des Gleichnisses berührte mein Herz ganz neu und ich wusste, dass ich diese bekannte Geschichte noch einmal tiefer studieren muss. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich vorher immer übersehen hatte.
Der barmherzige Samariter – Eine Geschichte mit viel Einfluss
„Von allen Geschichten, die Jesus erzählt hat, ist keine tiefer in die moralischen und juristischen Traditionen der westlichen Gesellschaft eingedrungen als diese außergewöhnliche kleine Geschichte. Ihr Einfluss geht weit über die Grenzen eines rein religiösen oder theologischen Diskurses hinaus. In der Moralphilosophie sowie in der Sozial- und Experimentalpsychologie dient das Gleichnis immer noch häufig als Ausgangspunkt für Diskussionen über Altruismus und das Wesen sozialer Verantwortung, während es in der Rechtstheorie nach wie vor Debatten über das Verhältnis zwischen Moral und Recht und den Umfang der persönlichen Haftung beeinflusst. Das Gleichnis hat auch in der medizinischen Ethik und bei der Gestaltung der Praxisregeln für andere helfende Berufe eine große Rolle gespielt. Das Gleichnis wird häufig zitiert, um karitative Aktivitäten auf lokaler Ebene zu fördern und die Philanthropie auf globaler Ebene zu inspirieren, insbesondere in Form von Nothilfe und Hilfsmaßnahmen. In der Politik wird der barmherzige Samariter manchmal benutzt, um militärische Interventionen in gescheiterten Staaten aus humanitären Gründen zu rechtfertigen, um die Menschenrechte zu wahren oder um unterdrückten Minderheiten zu Hilfe zu kommen. In jüngster Zeit hat das Konzept in Debatten über Einwanderung, Auslieferung und die Behandlung von Asylbewerbern sowie über die Verpflichtung zur Gastfreundschaft gegenüber Flüchtlingen und Vertriebenen eine Rolle gespielt.”
(Marshall 2012:21–22)
Aspekt 1: Der Kontext
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter findet sich nur im Lukasevangelium. Dort erzählt Jesus das Gleichnis als Antwort auf die Frage eines Gesetzeslehrers:
Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?
(Lk 10,25 ELB)
Diese Frage „war eine rabbinische Standardfrage, zu der es auch Standardantworten gab“ (Wright 2016:162). Es geht hier um die Frage, worauf es im Leben wirklich ankommt. Der Kontext ähnelt der Situation, in der Jesus nach dem wichtigsten Gesetz gefragt wurde (Mk 12 und Mt 22). Auch hier ging es im Grunde um dasselbe. Während Jesus bei Mk und Mt die Frage direkt beantwortet, gibt er sie hier aber an den Gesetzeslehrer zurück. Dieser reagiert genau wie Jesus in Mk 12,29–31 und Mt 22,37–40 und dementsprechend stimmt Jesus ihm voll und ganz zu.
Aber damit gibt der Gesetzeslehrer sich nicht zufrieden. Er schiebt eine Frage hinterher:
Und wer ist mein Nächster?
(Lk 10,29 ELB)
Warum stellt er diese Frage? In V. 25 steht, dass der Gesetzeslehrer Jesus versuchen wollte. Wie so viele andere Schriftgelehrte wollte er Jesus eine Antwort entlocken, die er dann später gegen ihn verwenden konnte. Strack und Billerbeck (1922–1926) erklären:
Nach der Halakha [das jüdische Gesetz] ist der Nächste (רֵעַ) eines Israeliten jeder Volksgenosse, aber nicht ein Nichtisraelit.
Für den Gesetzeslehrer war klar:
Gott ist der Gott Israels, also können nur Juden „Nächste“ sein.
(Wright 2016:161)
Wie weit reicht eigentlich Gottes Gnade?
Genau wie die Arbeiter im Weinberg ärgerte sich der Gesetzeslehrer vermutlich über die skandalöse Gnade, die Jesus verkündigte und dass er Tischgemeinschaft mit Sündern hatte. Erst kurz zuvor (Lk 8,26–39) hatte Jesus den besessenen Gerasener von seinen Geistern befreit. Dieses Erbarmen mit einem Heiden hatte sicher die Feindseligkeit einiger Schriftgelehrten gegenüber Jesus vertieft. Es geht hier also unter anderem um die Frage, wie weit Gottes Gnade reicht. Umfasst sie sogar Sünder und Heiden? Die Frage war …
… ist Israels Gott der Gott der Gnade für die ganze Welt?
(Wright 2016:161)
Aspekt 2: Es geht um Leben und Tod
Der Weg zwischen Jerusalem und Jericho ist „wüst und felsig“, „glühend heiß“ und eignet sich „ganz besonders für räuberische Überfälle“ (Strack und Billerbeck 1922–1926). Dieser Weg ist ungefähr 27 km lang, teilweise nur 2 Meter breit und galt als besonders gefährlich (Schürmann 1984–1994:142–143). Aufgrund der Herrschaft der Römer gab es in Jerusalem große Armut und viel Leid. Deshalb beschlossen viele, in die Wüste zu fliehen und Räuber zu werden. Die Armut war auch der Grund, weshalb sie ihren Opfern die Kleidung raubten (Zimmer 2011).
Auf dieser Straße verletzt in der glühend heißen Sonne zu liegen, vermutlich keinen Schatten und kein Wasser zu haben, bedeutete den sicheren Tod. Es geht in diesem Gleichnis also nicht um ein bisschen soziale Hilfe, sondern um eine lebensbedrohliche Situation. Das gilt nicht nur für das Opfer, sondern auch für den Helfenden. Niemand konnte schließlich garantieren, dass die Räuber tatsächlich weg waren. Vielleicht lauerten diese ja weiterhin ganz in der Nähe (Zimmer 2011).
Aspekt 3: Der Priester und der Levit
Der Priester und der Levit gehörten zur religiösen Élite. Ihre Jobs waren im AT bereits klar definiert. Ihre Positionen im Tempel und ihre spezifischen Aufgaben machten sie zu Repräsentanten des religiösen Systems. Sie waren in gewisser Hinsicht besser vor Räubern geschützt, weil sie meistens keine großen Reichtümer mit sich herumtrugen und ihre Berufskleidung für die Räuber schlechter nutzbar war (Zimmer 2011).
Priester und Levit konnte man nicht einfach werden, man musste in die entsprechende Familie hineingeboren werden. Von Kindheit an wurde man auf das geistliche Amt vorbereitet. Die zukünftigen Priester und Leviten waren dementsprechend seit Beginn ihres Lebens darauf konditioniert, sich von Leichen und Blut fernzuhalten, um die rituelle Reinheit (Lev 21,1–4; 22,4–7; Hes 44,25–27) zu wahren. Damit standen sie hinsichtlich der Versorgung des Verletzten vor einem Dilemma: Sollten sie den religiösen Regeln folgen, die ihr Leben bestimmten, oder sollten sie auf die Not des Mannes reagieren und Barmherzigkeit über ihre religiöse Prägung stellen? Sie entschieden sich dafür, die Erwartungen ihres religiösen Systems zu erfüllen. Vermutlich fühlten sie sich darin sogar gerechtfertigt, weil sie treu ihren religiösen Pflichten nachgekommen waren (Zimmer 2011).
Wann stellen wir religiöse Gebote über Barmherzigkeit und Liebe? Ich erinnere mich, wie ich vor 14 Jahren in Nepal in einem Dorf in den Bergen das Evangelium verkündigen durfte. Es war das erste Mal, dass das Dorf von Jesus hörte. Als ich fertig war, lud mich der Dorfchef in sein Haus ein. Er reichte mir einen Becher, randvoll gefüllt mit hochprozentigem Alkohol. Ich lehnte den Becher ab, weil wir als Missionare die Regel hatten, keinen Alkohol zu trinken. Der Dorfchef vertrieb unser gesamtes Team aus seinem Dorf. Ich hatte Regeln über Liebe gestellt und seinen Stolz verletzt, weil ich seine Gastfreundschaft (den Becher Alkohol) abgelehnt hatte. Damit hatte sich auch die Tür für das Evangelium in diesem Dorf verschlossen.
Aspekt 4: Sünde der Passivität
Schürmann betont, dass die bildliche Sprache der Bibel die Not des Mannes veranschaulichen soll. Sein Anblick war ein einziger Schrei nach Hilfe.
Niemand kann doch an einer derartigen Elendsgestalt vorbeigehen; jeder muß sich angefordert fühlen.
(Schürmann,1984–1994:143)
Der Priester und der Levit machten – gemessen an den religiösen Reinheitsgeboten – alles richtig. Das Problem war jedoch nicht, was sie taten, sondern das, was sie nicht taten. Juristisch gesehen hätten sie sich heute der unterlassenen Hilfestellung schuldig gemacht (obwohl es vermutlich mildernde Umstände gegeben hätte wegen der imminenten Gefahr durch die Räuber). Die Sünde der Passivität wiegt oft schwerer als unsere Tatsünden.
Wenn wir auf Unrecht blicken, das in der Vergangenheit geschehen ist, identifizieren wir uns gerne mit Helden wie z.B. Dietrich Bonhoeffer. Dieser leistete Widerstand gegen die schlimmsten Übel seiner Zeit. Aber was ist mit den großen Ungerechtigkeiten im Hier und Heute? Inwiefern helfen wir den 30 Mio. Menschen, die als moderne Sklaven täglich unfassbares Leid erleben? Obdachlose, Flüchtlinge, Waisen–es gibt auch heute genügend Möglichkeiten, wie Bonhoeffer das große Unrecht in dieser Welt zu bekämpfen.
Aspekt 5: Ein Oxymoron
Die meisten Gleichnisse Jesu sind tief im Alltag und der Realität der Leute verwurzelt. Aber in der Regel gibt es ein schockierendes Element (wie z. B. einen König, der große Schulden erlässt oder einen Gutsbesitzer, der skandalös gnädig ist). Das schockierende Element in dem vorliegenden Gleichnis ist der barmherzige Samariter. Für die Juden war dies ein Oxymoron. Es passte für sie nicht zusammen, dass Jesus einen Samariter, einen ihnen verhassten Feind, zur Heldenfigur in dieser Geschichte machte.
Zwischen den Juden und den Samaritern bestand eine tiefe Abneigung und Feindschaft. Die Samariter waren heidnischer Herkunft, und sie wurden in der Synagoge öffentlich verflucht. Nie wurden sie als Proselyten angenommen; ihre Speise zu essen wurde dem Essen von Schweinefleisch gleichgesetzt; und es war für einen Juden besser zu leiden, als ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen.
(Briem 2003–2006:109)
Der Hass zwischen Juden und Samaritanern war schon Jahrhunderte alt – und spiegelt sich tragischerweise bis heute in den brodelnden Spannungen zwischen Juden und Palästinensern.
(Wright 2016:161)
Wenn man das Gleichnis heute einem evangelikalen Christen erzählen würde, könnte man vielleicht die Rollen wie folgt besetzen: Ein Missionar und ein Erweckungsprediger gingen an dem Mann vorbei und der liberale Theologe eilte zu Hilfe (Zimmer 2011).
Der barmherzige Samariter: Nächsten- und Feindesliebe
Jesus stellte bewusst einen verhassten Staatsfeind als denjenigen dar, der das wichtigste Gebot Gottes erfüllt und seinen Willen tut. Dadurch erweiterte Jesus die Bedeutung der Nächstenliebe um die Feindesliebe und sprach damit das grundlegende Problem in der Weltanschauung des Gesetzeslehrers an.
Er [Jesus] fordert Israel heraus, zu erkennen, dass der Weg der Konfrontation mit Samaritanern, Römern und Heiden jeglicher Art nicht der Weg ist, Gottes Gnade zu leben und zu zeigen. Mit großer Dringlichkeit lädt er ein, den Weg des Friedens zu gehen. Nur die „Kinder des Friedens“ (Kapitel 10,16) werden dem selbstverschuldeten Gericht entkommen, das über alle hereinbrechen wird, die auf Gewalt vertrauen. Im Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Gesetzeslehrer steht die Konfrontation zwischen zwei ganz unterschiedlichen Visionen dessen, was es bedeutet, Israel – Gottes Volk – zu sein.
(Wright 2016:162)
Jesus konfrontiert den Gesetzeslehrer mit dessen enger und selbstzentrierter Vision des Königreiches Gottes. Es ist der Samariter, der die Feindesliebe lebt, die Jesus durch seine Lehren und sein Leben verkündigt. Und er tut das, obwohl er sich durch das Helfen selbst in Gefahr begibt – aufgrund seines Reittiers stellte er nämlich für die Räuber eine lukrative Beute dar. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter spiegelt wider, dass Gottes Reich nicht exklusiv ist, sondern Gottes Liebe zu den Menschen aller Völker zeigt. Jesu Entscheidung, einen Samariter zum Vorbild der Geschichte zu machen, stellt …
… eine radikale Subversion der vorherrschenden sozialen und politischen Werte dar. Dies ist eine der Weisen, wie das Gleichnis, auch wenn es die individuelle Verantwortung für die Benachteiligten und die Notwendigkeit einer inneren Veränderung des Charakters betont, um von ganzem Herzen zu lieben, gleichzeitig auf die Notwendigkeit eines strukturellen und systemischen Wandels als soziales Ergebnis der Liebe hinweist.
(Marshall 2012:138)
Aspekt 6: Das Wirtshaus
Interessant ist, dass Lukas hier ein anderes griechisches Wort für das Wirtshaus (pandocheion) verwendet als für Herberge (katalyma) in Lukas 2,7. Ein Wirtshaus (pandocheion) war eine Art Sündenpfuhl.
Auf der anderen Seite die gewerbliche Wirtsherberge (πανδοχεῖον pandocheion), die in der gesamten Antike einen schlechten Ruf hatte (…). Zudem verkehrte in den letzteren Herbergen fast nur Publikum aus unteren Gesellschaftsschichten, das keine Gastfreunde hatte, was entsprechend Standards und Umgangsformen der Wirtshäuser prägte. Die Wirtsherbergen galten ferner als Orte des Lasters, denn vom weiblichen Bedienungspersonal wurde allgemein erwartet, dass es auch die sexuellen Wünsche der Gäste erfüllte.
(Kirchhoff 1994, 37ff.) (Esch-Wermeling 2015:545)
Der Samaritaner war vermutlich auch noch nie in solch einem Wirtshaus eingekehrt. Jesus beschreibt ihn ja als einen gottesfürchtigen Menschen, dessen Rechtschaffenheit die des Priesters und des Leviten übertrifft. Aber der Samariter sieht die Not des Mannes, überwindet sich und bringt den Kranken dorthin, damit dieser wieder zu Kräften finden kann.
Das Wirtshaus gibt es übrigens wirklich, es wurde gefunden und kann heute in einem Museum, ca. 5 km von Jericho entfernt, besichtigt werden (Zimmer 2011).
Aspekt 7: Die Kirchenväter
Der barmherzige Samariter spiegelt tatsächlich Jesu Werte und Lehren so sehr wider, dass die frühen Kirchenväter das Gleichnis allegorisch auslegten und den Samariter als Bild für Jesus verstanden.
Für Origenes, wie auch für Ambrosius und Augustinus nach ihm, können wir in dem armen Reisenden, der von Jerusalem nach Jericho hinabsteigt, einer Stadt, die mit der Sünde der Welt identifiziert wird, eine Art Jedermann-Figur sehen, die in seinem Abstieg von der göttlichen Absicht die allgemeine Reise in die gefallene Welt des ersten Adam verkörpert. In dieser Lesart stehen die Räuber für die dämonischen Angriffe und Plünderungen der Sünde, die uns in der Tat ihrer Substanz beraubt und halb tot zurücklassen. Der Priester und der Levit stehen für das Gesetz und die Propheten bzw. für die Einrichtungen der Religiosität, die unserem Zustand nicht dienlich sind. Christus ist der barmherzige Samariter, der von diesen religiösen Personen und Institutionen als Ausgestoßener angesehen wird, der aber in Wirklichkeit den Verlorenen auf eigene Kosten sucht und rettet. Das Gasthaus ist wie die Kirche, die den verwundeten ersten Adam aufnimmt, für den der zweite Adam, Christus, allein die rettende Vorsorge getroffen hat. Dieser Christus wird übrigens eines Tages zu seiner Kirche zurückkehren und alles wiedergutmachen.
(Reno 2012:151)
In meinem zuletzt veröffentlichten Artikel erkläre ich ausführlich, wie die ersten Christen das Kreuz und die Auferstehung Jesus verstanden haben.
Aspekt 8: Angemessene Hilfe
Der Abschnitt endet mit Jesu Aufforderung:
Geh hin und handle du ebenso!
(Lk 10,37 ELB)
Dies kann als ein universaler Befehl Jesu verstanden werden. Er ruft alle Menschen dazu auf, dem Beispiel des barmherzigen Samariters zu folgen.
Keine Kirche, kein Christ darf sich mit einfachen Definitionen zufriedengeben, die es uns erlauben, einen großen Teil der Welt halbtot im Straßengraben liegen zu lassen.
(Wright 2016:163)
Diese Aufforderung kann im Angesicht des großen Leids der Welt schnell überfordernd sein. Es gibt so viele Nöte, dass der Druck helfen zu müssen, sehr schnell im Burnout enden kann. Auch hier ist es gut, noch einmal genauer hinzuschauen und von dem Samariter zu lernen.
Der Samariter lässt sich auf seiner Reise unterbrechen, aber er krempelt auch nicht sein gesamtes Leben für den Verletzten um. Er erkennt seine Grenzen und bindet deshalb den Wirt ein (was Kreativität beweist), bezahlt eine große Summe für die Pflege des Mannes und zieht dann weiter (Zimmer 2011). Der Samariter sieht die Not, lässt sich berühren, hilft so gut er kann, tritt dann aber wieder aus der Situation heraus. Wer beim Helfen selbst ausbrennt, kann nicht langfristig für andere da sein. Auch Selbstfürsorge ist wichtig. Es geht darum, die Balance zu finden. Der Samariter deutet an, was es bedeutet, andere Menschen so zu lieben, wie man sich selbst liebt.
Fazit
Die Frage des Gesetzeslehrers war, wie weit Gottes Gnade reicht. Jesus lässt keinen Zweifel: Israels Gott ist der Gott der Gnade für die ganze Welt. Gottes Liebe kennt keine ethnischen Grenzen.
Unter der Oberfläche der offensichtlichen moralischen Lektion („Geh hin und handle auch so!“) finden wir eine viel ernsthaftere Herausforderung, die genau zu dem passt, was Lukas bis hierher betont hat: Kannst du den verhassten Samaritaner als Nächsten anerkennen?
(Wright 2016:162)
Wie so oft fordert Jesus den Gesetzeslehrer heraus, alte enge Denkmuster zu überwinden. Er ermutigt ihn, sich auf Gottes unbeschreibliche Gnade und Liebe einzulassen. Diese Liebe gilt sogar den eigenen Feinden.
In seiner letzten Predigt rief Martin Luther King seine Zuhörer auf, die Eigenschaft der „gefährlichen Selbstlosigkeit” zu kultivieren, die der Samariter im Gleichnis Jesu an den Tag legte. King stellte sich vor, dass der Priester und der Levit, als sie den Mann im Graben entdeckten, sich fragten: „Wenn ich anhalte, um diesem Mann zu helfen, was wird dann mit mir geschehen?”, und aus Angst um ihre eigene Sicherheit entschieden sie sich, nicht einzugreifen. Der Samariter kehrte die Frage um: „Wenn ich nicht anhalte und diesem Mann helfe, was wird dann mit ihm geschehen?” Das ist es, was den barmherzigen Samariter zum idealen Vorbild für Bürger und politische Entscheidungsträger aller Zeiten macht.
(Marshall 2012:176)
Ich möchte schließen mit einem Zitat von Pastor Mark Sandlin:
Nach eingehendem Studium bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Jesus glaubte, dass es zwei Arten von Menschen gibt: deine Nachbarn, die du lieben sollst, und deine Feinde, die du lieben sollst.
Bibliografie
Briem, C. (2003–2006) Er lehrte sie vieles in Gleichnissen. 2. Auflage. Hückeswagen: Christliche Schriftenverbreitung.
Esch-Wermeling, E. (2015) „Berührende Liebe (Der barmherzige Samariter)“, in Zimmermann, R. (Hrsg.) Kompendium der Gleichnisse Jesu. 2., korrigierte und um Literatur ergänzte Auflage 2015. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus (Kompendien der Gleichnisse/Wunder).
Marshall, C.D. (2012) Compassionate Justice: An Interdisciplinary Dialogue with Two Gospel Parables on Law, Crime, and Restorative Justice. Hrsg.: T. Heilke, D.S. Long und C.C. Pecknold. Eugene, OR: Cascade Books (Theopolitical Visions).
Reno, R.R. (2012) „Series Preface“, in Luke. Grand Rapids, MI: Brazos Press (Brazos Theological Commentary on the Bible).
Strack, H.L. und Billerbeck, P. (1922–1926). Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck
Schürmann, H. (1984–1994) Das Lukasevangelium. Sonderausgabe. Herausgegeben von J. Gnilka und L. Oberlinner. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament).
Wright, N.T. (2016) Lukas für heute. Übersetzt von J. Alberts. Giessen: Brunnen Verlag GmbH (Das Neue Testament für heute).
Zimmer, Siegfried (2011). Das Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner (LK 10,30–35) | 1.3.1 https://worthaus.org/mediathek/das-gleichnis-vom-barmherzigen-samaritaner-lk-1030–35‑1–3‑1/




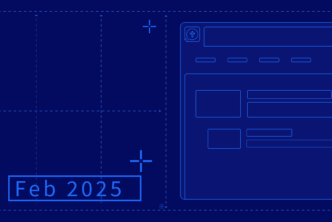

Vielen Dank fuer Deine vielschichtige Auslegung, Manuel.
Was haelst du von dieser Argumentationskette:
1) Es geht um „Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?” v.a. und zu allererst, als Hauptpunkt um das ewige Leben, oder?
2) Jesus zeigt dem Gesetzeslehrer auf: Judentum reicht (bald) nicht mehr! Weil er DARF und KANN, um guter Jude zu sein, nicht helfen. Also bliebe ihm deshalb auch „ewiges Leben” verwehrt, oder?
3) Man KANN zwar auch moralisch ableiten, jedem in jedem Setting in dieser Welt helfen zu sollen, aber das ist nicht der Hauptpunkt sondern ein Nebenpunkt, oder siehst du das gleichwertig?
4) Der Hauptpunkt ist die Errettung zum Erbe des ewigen Lebens. Deshalb scheint mir die Auslegung der Kirchenvaeter auch heute noch die Hauptsache zu sein! Jesus ist MEIN barmherziger Samariter! Welche Gnade!
5) Insofern passt deine Uebertragung „Ein Missionar und ein Erweckungsprediger gingen an dem Mann vorbei und der liberale Theologe eilte zu Hilfe.” hier ueberhaupt nicht!
Der liberale Theologe lindert vielleicht die momentane, irdische Not, aber ich vermute du meintest mit „liberalem Theologe” eben gerade, dass er niemanden zur Lebensuebergabe an Jesus Christus fuehren kann, oder?
6) Eine passende Uebertragung koennte also sein: „Ein Levit und ein Imam gingen an dem Mann vorbei und ein Christ sorgte fuer Seife, Suppe UND Seelenheil”, etwas provokativ, aber waere das deiner Meinung nach in Christi Sinne?
LG Joerg
Hallo Joerg.
Danke für deine Gedanken zu dem Gleichnis.
Du hast vollkommen recht, dass die Einstiegsfrage sich um das ewige Leben dreht, aber die direkte Frage, die Jesus beantwortet, ist die Frage, wer der Nächste ist. Das dramatische Element in dem Gleichnis ist, dass der gehasste Feind, der Samariter, der ist, der hilft. Dies war, was die Zuhörer vermutlich verstörend fanden und worüber die nachgedacht haben. Das ist der Grund, weshalb ich die Feindeliebe in den Fokus meiner Auslegung stelle.
Das Tolle an Gleichnissen ist, dass sie vielschichtig verstanden werden und auf unterschiedliche Weisen zu uns reden können. Heute können wir vielleicht andere Dinge aus einem Gleichnis mitnehmen als die ursprünglichen Zuhörer. Aber da gibt es natürlich auch immer die Gefahr, eigene Ideen in den Text zu lesen.
Ich denke nicht, dass ein einziger der ursprünglichen Zuhörer auf die Idee gekommen wäre, dass das Judentum nicht genug ist. Dieser Gedanke war den Juden damals vermutlich vollkommen fremd, insofern weiß ich nicht, ob das eine zulässige Auslegung ist.
Weiterhin denke ich nicht, dass Jesus gepredigt hat, dass er das Judentum abschafft. Er war selbst Jude und er ist die Erfüllung vom Judentum. Jesus ist der jüdische Messias und jeder Jude, der ihm nachfolgt, wird gerettet werden. Keiner der ersten Jünger Jesu hätte sich als Christ verstanden. Ihre religiöse Identität war „Juden, die den Messias gefunden haben“.
Ich denke viele der Gleichnisse sind Geschichten, die uns schocken und durch das schockierende Element Augen für die Wahrheit öffnen sollen. Dein Vorschlag mit dem Imam, Levit und Christ bewirkt das Gegenteil. Wir, als Christen, klopfen uns auf die Schulter und sagen „Alles gut, meine Religion ist die Richtige.” Das Gleichnis verliert sein schockierendes Element.
Aber wenn Jesus mein Feindbild als den Helden der Geschichte darstellt, dann provoziert mich das und bringt mich zum Nachdenken. Und genau das sollen Gleichnisse bewirken.
Das sind ein paar meiner Gedanken zu deinen Anregungen. Ich könnte natürlich falschliegen, aber das ist, wie ich es aktuell verstehe.
Liebe Grüße und danke für die spannende Frage!
Manuel
Danke Manuel,
die Vielschichtigkeit des Gleichnisses ist auch fuer mich klar.
zu „Ich denke nicht, dass ein einziger der ursprünglichen Zuhörer auf die Idee gekommen wäre, dass das Judentum nicht genug ist. Dieser Gedanke war den Juden damals vermutlich vollkommen fremd, insofern weiß ich nicht, ob das eine zulässige Auslegung ist.”
Das stimmt. Die Frage ist aber, warum/zu welchem Zweck hat Lukas das Gleichnis aufgenommen? Letztendlich sind die Evangelien in ihrer Gesamtheit dem Ziel verpflichtet, Christus gross zu machen, als Sohn Gottes, als Weg des Heils, als unser „einziger barmherzige Samariter”, der uns verwundete, gebrochene, missbrauchte Kreaturen alle aufsammelt, fuer uns bezahlt und ins himmlische Wirtshaus bringt? Also ich meine, Lukas hat das aufgenommen, um genau dass herauszustellen, „der neue Weg” geht ueber das bisher Bekannte hinaus?
Fuer mich sind die Indizien:
– die Frage nach dem „Ererben des ewigen Lebens” steht im Vordergrund, die humanistische Hilfe am Naechsten ist nicht gleichwertig oder reicht als Zweck fuer das Gleichnis nicht aus
– warum waehlt Jesus: juedische Wuerdentraeger wie Levit und Priester als am Opfer vorruebergehend, warum nicht auch „normale” Menschen oder einen „Gesetzeslehrer” wie sein Befrager?
– warum hilft dem Opfer nicht ein normaler Mensch, ein Gesetzeslehrer oder ein Roemer (waere auch krass), sondern ein Samariter (religioese Komponente: Israeliten, die zwar auch Gott suchen, aber es aus Sicht der Juden falsch machen/Abgefallene sind)
– bei der Bergpredigt und unzaehligen anderen Stellen ist die Botschaft stets: das Befolgen von Gesetzen und Regeln wird nicht ausreichen! Der beste Humanist wird nicht vor Gott bestehen koennen?
– damals war die Not so gross, dass an allen Ecken und Enden im Alltag einem Hunger, Mangel, Krankheit, Beduerftigkeit entgegen gesprungen sind. Allen war stets klar, so viel Leid kann man gar nicht aus eigener Kraft lindern; wegschauen, verdraengen gehoert zum Alltag (heute ist das im Prinzip genauso der Fall). Anders koennen wir nicht leben, sonst wuerden wir wahnsinnig werden.
zu „Weiterhin denke ich nicht, dass Jesus gepredigt hat, dass er das Judentum abschafft. Er war selbst Jude und er ist die Erfüllung vom Judentum. Jesus ist der jüdische Messias und jeder Jude, der ihm nachfolgt, wird gerettet werden. Keiner der ersten Jünger Jesu hätte sich als Christ verstanden. Ihre religiöse Identität war „Juden, die den Messias gefunden haben“
Ich denke viele der Gleichnisse sind Geschichten, die uns schocken und durch das schockierende Element Augen für die Wahrheit öffnen sollen. Dein Vorschlag mit dem Imam, Levit und Christ bewirkt das Gegenteil. Wir, als Christen, klopfen uns auf die Schulter und sagen „Alles gut, meine Religion ist die Richtige.”.
Volle Zustimmung. Das war eine Provokation. Keinem ausser Jesus Christus, kann der Schuh „barmherziger Samariter” passen, wenn es um das Seelenheil geht. Ginge es nur um humanistische Hilfeleistung, gaebe es freilich viele Menschen …
Vielen Dank Manuel fuer die interessante Diskussion
LG Joerg
Hallo Joerg.
Du hast geschrieben:
Was für eine tolle Zusammenfassung des Evangeliums. Da bleibt mir nichts, außer Amen zu sagen und dir von Herzen zuzustimmen.
Danke für das spannende Gespräch!
LG
Manuel
Danke für die interessanten theologischen Ausführungen!
Noch was Nettes dazu…
Rätsel – Eine Reisegruppe ist durch Israel unterwegs – der Reiseleiter sagt: „Heute besuchen wir die berühmte Strecke zwischen Jerusalem und Jericho- wo der barmherzige Samariter dem verletzten Mann geholfen hat!”
Frage: Warum ist die Besichtigung dieser Stelle nicht möglich?
Spannende Frage. Ich weiß die Antwort nicht, bin aber gespannt sie zu hören!
Ganz einfach:
(wie schon oben geschrieben:)
Der barmherzige Samariter – jeder kennt dieses Gleichnis.
also – > GLEICHNIS
und für GLEICHNISSE kann man keinen tatsächlichen Ort bestimmen !
Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung. Sie dient zur Veranschaulichung eines Sachverhalts nicht durch einen Begriff, sondern durch bildhafte Rede. Über die Veranschaulichung hinaus wird dem Gleichnis auch verändernde Funktion zugeschrieben. Der Hörer/Leser soll sich in der Erzählung selbst entdecken können und damit eingeladen werden, seine Situation zu verändern
Eine Anmerkung zum Aspekt 5, dem Samariter: Steckt darin nicht auch die Aussage, dass jeder „Fromme” auch angewiesen sein kann und darf auf die Hilfe des nicht „richtig” Frommen? Ja, es ist klug zu überlegen, mit wem wir einen Bund eingehen. Und doch dürfen wir auch bei „nicht Frommen” sehen/anerkennen, wo sie voll im Willen Gottes unterwegs sind, von ihnen lernen, mit Ihnen kooperieren, vielleicht auch als Gemeinde Gutes von Außenstehenden empfangen und auch deren Beitrag zu gelingender gottgefälliger Gesellschaft mehr würdigen. An mancher Stelle könnte das das Klima zum Guten verändern.
Das ist eine wertvolle Ergänzung! Dem stimme ich ganz zu. Danke für das Teilen dieses Gedankens.
Ihr 8 Fakten zum Gleichnis ähnelt 1:1 dem Worthausvortrag von Professor Siegfried Zimmer , veröffentlich am 8.April 2011.
https://worthaus.org/mediathek/das-gleichnis-vom-barmherzigen-samaritaner-lk-1030–35‑1–3‑1/
Wer wissenschaftlich arbeitet, sollte alle Quellen angeben.
Hallo Frau Winterbauer.
Vielen Dank für Ihren Kommentar. Sie haben vollkommen recht, dass ich zur Vorbereitung den Podcast von Dr. Zimmer gehört und davon auch teilweise Gedanken übernommen habe. Ich hatte damals noch einige andere Bücher und Kommentare gelesen und der vorliegende Artikel ist ein bunter Mix dieser Vielfalt an Quellen. Dr. Zimmer erwähnt z. B. keine einzige der vielen Quellen, die ich zitiere. Dass ich den Podcast nicht erwähnt habe, lag daran, dass ein Podcast gewöhnlich nicht als wissenschaftliche Quelle zählt und ich deshalb die Bücher als Quelle angegeben habe. Viele Gedanken doppeln sich ja auch in der Literatur und sind keine exklusiven Gedanken von Dr. Zimmer. Aber um auch Dr. Zimmers Beitrag besser zu würdigen, habe ich gestern noch einmal den ganzen Podcast gehört und die Gedanken, die auch bei Dr. Zimmer vorkommen, entsprechend in meinem Artikel gekennzeichnet.
Demnach, danke noch einmal für den hilfreichen Hinweis.
Mit freundlichen Grüßen
Manuel Becker