
Inhalt
Eine gewachsene Liebe
Die Schlachter-Bibel war nicht immer meine bevorzugte Bibel. Als ich das erste Mal von dieser Übersetzung hörte, kam mir „Schlachthof“ in den Sinn, sowie Blut und Opfertiere. Diese Abneigung war für mich lange Zeit Grund genug, um mich dieser Übersetzung über längere Zeit zu verweigern.
Doch dann hörte ich immer wieder, dass theologisch interessierte Blogger die Schlachter den anderen Übersetzungen vorziehen. Das machte mich neugierig, und ich machte mich daran, diese Übersetzung genauer anzuschauen …
Woher hat die Übersetzung ihren Namen?
Nein, der Name der Übersetzung hat nichts mit Schlachttieren zu tun, sie verdankt ihren Namen vielmehr ihrem Übersetzer: Franz Eugen Schlachter. Um 1900 übersetzte er die Bibel im Alleingang. Er war Prediger in Bern (Schweiz) und gehörte der Erweckungsbewegung an. Die Übersetzung hat also freikirchliche Wurzeln.
Schlachter war – wie Luther – missionarisch motiviert: Er übersetzte die Bibel, um seine Zeitgenossen zum Bibellesen zu motivieren. Er gab die „Miniaturbibel“ (so der Name der ersten Ausgabe) mit dem Ziel heraus, dass Christen die Bibel immer mit sich tragen können.
Bei seiner Übersetzung orientierte sich Schlachter an den schon bestehenden Übersetzungen von Luther und der Zürcher Bibel. Die drei Übersetzungen sind sich sehr wesensähnlich: Christliche Begriffe, wie Sühne bleiben bestehen, aber der übrige Wortschatz fällt in den neueren Ausgaben relativ zeitgemäß und gut verständlich aus.
Der Erfolg der Schlachter-Bibel war beträchtlich: Schon nach sechs Jahren war sie in der Schweiz verbreiteter als die Luther- und die Elberfelder Bibel.
Sprachliche Unterschiede zu Luther
Als Vergleich zur Lutherübersetzung hier eine der komplizierteren Stellen des NT – Römer 3,25:
| Schlachter 2000 | Luther |
|---|---|
| Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, [das wirksam wird] durch den Glauben an sein Blut | Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut |
| um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, | zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. |
Die Lutherübersetzung lässt den Zusammenhang zwischen Glauben und Sühne etwas im Unklaren. Anders die Schlachter: der klar gekennzeichnete Einschub [das wirksam wird] erklärt den Zusammenhang. Des Weiteren scheint es in der Lutherübersetzung so, dass Gott seine Gerechtigkeit beweist, indem er die Sünden vergibt. Das macht keinen Sinn, denn Sünden vergeben ist ja gerade eine Abkehr der Gerechtigkeit.
Schlachter löst dies anders: Statt indem wählt er weil (das auch näher am Urtext ist), und statt Sünden vergibt übersetzt er mit Sünden ungestraft ließ (auch dies wiederum näher am Urtext). Damit erklärt er Gottes Dilemma, dass er durch das „ungestraft lassen“ der früheren Sünden seiner Gerechtigkeit nicht nachkam, nun aber mit Jesus als Sühneopfer die geschuldete Gerechtigkeit wieder aufrichtet.
Man spürt förmlich, wie es Franz Eugen Schlachter ein Anliegen war, solch zentrale Wahrheiten seinen Leuten zu erklären. Mit dem Verständnis der Bibel steht und fällt eine Erweckung – das hat Schlachter verstanden und dementsprechend viel in seine Bibel investiert.
Wie zeitgemäß ist die Schlachter-Bibel?
Seit der Publikation der Miniaturbibel von 1905 sind inzwischen über hundert Jahre vergangen und auch der deutsche Sprachgebrauch hat sich gewandelt. Zwei behutsame Revisionen trugen dem bis 1951 Rechnung. In den 1970er Jahren ging die Genfer Bibelgesellschaft erneut den Plan an, die Schlachter-Übersetzung aufzufrischen.
Doch anstatt der Schlachter-Bibel bloß eine modernere Sprache zu verpassen, ging man am Ende noch einen Schritt weiter: Man entschied sich dafür, eine ganz neue kommunikative Bibelübersetzung zu schaffen. Diese neue Übersetzung bekam dann auch einen anderen Namen: die „Neue Genfer Übersetzung“ (NGÜ).
Doch das eigentliche Anliegen stand immer noch auf dem Tisch, die Schlachter-Bibel sprachlich zu aktualisieren. Schließlich wurde die Übersetzung ab 1995 revidiert, allerdings mit Zurückhaltung – diese sah man einerseits aufgrund des Anspruchs geboten, eine wörtliche Übersetzung zu sein, andererseits aus Respekt vor den vielen Gemeinden, welche sich über viele Jahrzehnte an den Schlachter-Wortlaut gewöhnt hatten. So tauschten die Revisoren veraltete Wörter aus und entwickelten einen Parallelstellen-Apparat. Die Schlachter-Bibel 2000 erschien 2003.
Zum Unterschied des Sprachgebrauchs zwischen Schlachter und NGÜ folgt ein Beispiel aus Mt 6,19, wo die Schlachter 2000 das etwas schwer verständliche Wort nachgraben wählt.
| Schlachter 2000 | NGÜ |
|---|---|
| Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. | Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. |
Im Vergleich zu anderen wörtlichen Übersetzungen (Luther und der neuen Zürcher Bibel 2007) ist die Schlachter aber ebenbürtig, was den modernen Sprachgebrauch angeht. Ein weiterer Unterschied zur NGÜ ist, dass die Schlachter im Neuen Testament aus dem historischen „Textus Receptus“ übersetzt, wobei NGÜ, Luther und die meisten anderen deutschen Übersetzungen mittlerweile auf dem griechischen NT von „Nestle Aland“ beruhen.
Zur Schlachter-Bibel 2000 für Logos.
Alles in allem finde ich persönlich die Schlachter-Übersetzung sehr gelungen, sodass sie mittlerweile die Hauptbibel für mein tägliches Bibelstudium ist, wie auch für das Auswendiglernen von Bibelversen.
Weil die Schlachter-Bibel in Logos eingebunden ist, bedeutet das, dass Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Suche nutzen könnten, wie auch die Verlinkungen, Vergleiche zu anderen Übersetzungen und weitere Features.
Hier finden Sie außerdem die Erweiterte Interlinearbibel zur Schlachter-Bibel 2000.




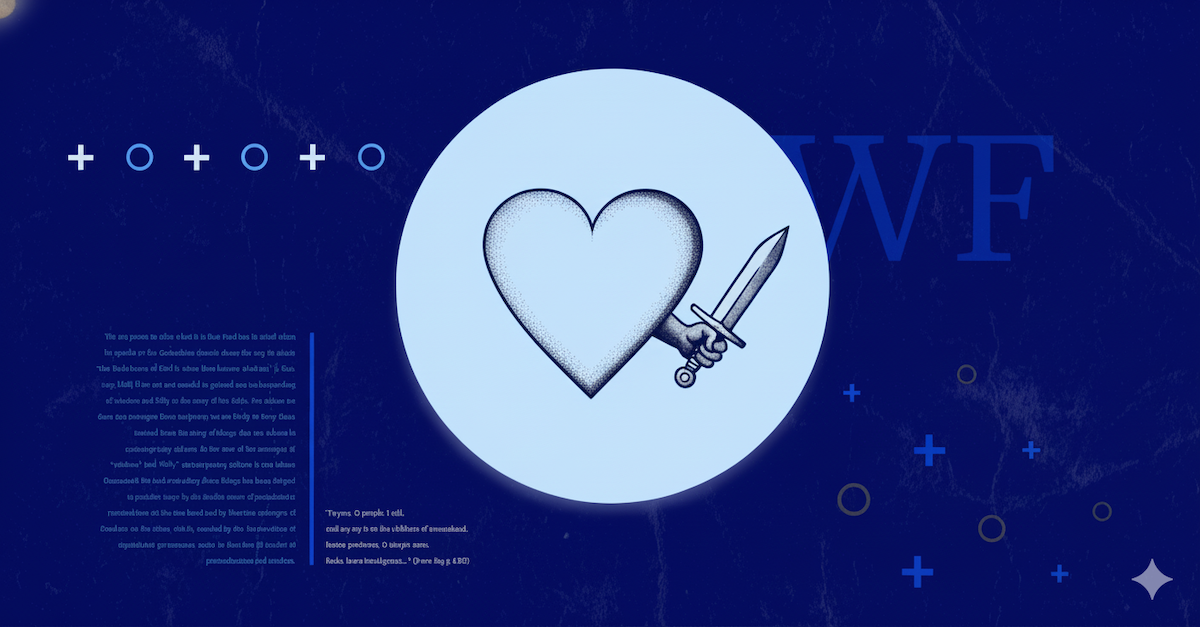
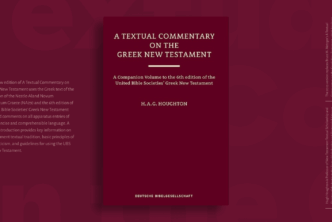
[…] Einführung […]
Guten Tag Herr Keller
Gibt es auch Bestrebungen eine Elberfelderübersetzung interlinear einzuführen? Da ich die Luther sowieso nur mit äussersten Vorsicht lese, habe ich sofort eine Pre-Pub-Bestellung der Schlachter getätigt. Lieber wäre mir die erwähnte Elberfelderübersetzung interlinear zu besitzen.
Bestrebungen schon, aber SCM muss auch mitmachen wollen und da leistet Faithlife Überzeugungsarbeit.
Wir als Nutzer können unesere Wünsche auch so kundtun (auch dem Verlag gegenüber), indem wir für diese Bibeln abstimmen. Für folgende Interlinear-Bibeln wird momentan abgestimmt:
1. Rev. Elberfelder Bibel 2006: https://suggestbooks.uservoice.com/forums/308269-book-suggestions/suggestions/17678611-erweiterte-interlinearbibel-zur-rev-elberfelder‑b
2. Rev. Elberfelder Bibel 2006 („Premium Edition”): https://suggestbooks.uservoice.com/forums/308269-book-suggestions/suggestions/17678641-erweiterte-interlinearbibel-zur-rev-elberfelder‑b
3. Elberfelder Bibel – Edition CSV Hückeswagen: https://suggestbooks.uservoice.com/forums/308269-book-suggestions/suggestions/17678683-erweiterte-interlinearbibel-zur-elberfelder-bibel
4. Rev. Elberfelder Bibel 1985: https://suggestbooks.uservoice.com/forums/308269-book-suggestions/suggestions/17678716-erweiterte-interlinearbibel-zur-revidierten-elberf
4.
Vielen Dank für den guten Tipp und Links.
Ja, wie „Ein Logos-Nutzer” schon sagt, hätten wir eine Elberfelder‑I+ natürlich auch gerne im Angebot. Das wird aber warten müssen, bis wir entweder die Elberfelder 2006 oder die Elberfelder CSV lizenzieren können. Wir sind recht zuversichtlich, dass das früher oder später der Fall sein wird! 🙂
Guter Post, aber … und das soll den Post nicht relativieren … ich denke der eigentliche Knackpunkt bei der Schlachterbibel ist eben genau der Textus Receptus als Grundlage für das Neue Testament und nicht der Nestle-Aland. Das ist nicht nur ein technischer Unterschied, sondern auch ein theologischer (um nicht zu sagen ideologischer).
Am besten sieht man das an der KJV-Only Diskussion in den USA. Die KJV = King James Version beruht ebenfalls auf dem Textus Receptus und wird von manchen als die einzig inspirierte Übersetzung angesehen, während andere sie rundheraus ablehnen.
Mir persönlich gefällt die Schlachterübersetzung gut, aber theologisch bevorzuge ich den Nestle-Aland als Basis. Aber dafür hat man ja Logos und kann dann z.B. die NGÜ daneben legen und die Unterschiede sehen oder – wenn die Interlinearbibel da ist – direkt im Original schauen was da im Textus Recptus hinzugefügt wurde. Ich lese allerdings die meisten Dinge auf Englisch und von daher habe ich jetzt schon die Auswahl an Interlinearbibeln zu den meisten wichtigen Übersetzungen. Hier ist im Deutschen echt noch Aufbauarbeit zu leisten und die Schlachter-Interlinearbibel (bzw. Reverse Interlinear) ist ein wichtiger Schritt aus meiner Sicht.
Danke für diesen Kommentar! Mir geht es ganz genauso. Die Schlachter 2000 hat im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar eine in Ansätzen vergleichbare Fangemeinde wie andere TR-Übersetzungen in Amerika.
Obwohl ich persönlich methodische Vorbehalte gegenüber dem TR habe, schätze ich die Schlachter-Bibel doch als recht gelungene „wörtliche, aber nicht unverständliche” Übersetzung. In der Praxis merke ich relativ selten einen greifbaren Unterschied. Und bei Logos schätzen wir den Aspekt umso mehr, dass wir damit auch einen Bedarf für Kunden erfüllen können, die diese Sache anders sehen.
Und vorbestellt habe ich sie auch schon 🙂 Alleine schon deshalb, weil ich es unterstützen will, dass Logos sein Angebot an deutschsprachigen Bibeln ausweitet.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine Interlinear-Verknüpfung des deutschen mit dem griechischen Text nicht gerade von alleine macht, also kostet es auch Geld.
Ich denke aber auch, dass Logos in späteren Versionen die Schlachter-Interlinear in ein Basis-Paket packen wird, wenn die Anschubfinanzierung erstmal erfolgt ist.
Ja, der TR stört mich auch. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass in der Schlachter die Stellen mit Randbemerkungen versehen sind, welche sich von der Nestle Aland unterscheiden. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Wie auch immer, ich habe hier eine gute Übersicht gefunden über die Unterschiede: http://www.kjvtoday.com/home/q‑are-the-differences-between-the-textus-receptus-and-nestle-aland-important (@Ben: vielleicht kennst Du noch eine bessere Quelle?)
Wenn ich die Liste durchlese dann fällt mir auf, dass es keine wirklich frappanten Unterschiede gibt, so dass man darauf eine abweichende Lehre ableiten könnte. Ich finde es erstaunlich, dass sich zwei Abschriften über Jahrhunderte voneinander weiterentwickelt hatten und danach nur in so wenigen Punkten unterscheiden.
Hi,
Du kannst es je nach Ausstattung auch mit dem Versionsvergleich von Logos sehen, indem Du die Schlachter (oder KJV) mit einer anderen Bibel vergleichst. Da sieht man dann, dass ganze Stellen nicht einfach nur anders übersetzt wurden, sondern komplett fehlen. Allerdings sieht man so nicht alle Details, dafür müsste man dann den NA mit dem TR im Griechischen Original vergleichen.
Jemand von Faithlife (Mark Ward) arbeitet gerade an einem Projekt, welches die KJV so darstellt, als wenn sie auf Basis des NA übersetzt worden wäre und will damit aufzeigen, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat auch ein Buch dazu in Arbeit, das es als pre-pub gibt: „Authorized: The Use and Misuse of the King James Bible”
Moin Leude,
Ich beschäftige mich jetzt schon seit über 2 Jahren mit der Grundtextfrage (NA contra TR/Mehrheitstext) und habe dazu fast alles gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Ich selbst bin nicht vom Fach und kann auch kein Griechisch, ich bin Laie, dafür aber wahnsinnig interessiert .-) … und selber noch unentschlossen. Wenn ich die Argumente pro NA lese, dann bin ich davon überzeugt. Wenn ich dann die Argumente pro Mehrheitstext/TR lese, dann überzeugt mich das! Immer hin- u. her. Und das ist für mich unbefriedigend!
Warum haltet ihr den NA als den bessen Text als zB den Mehrheitstext (ich schreib bewußt nicht TR, da dieser seine unstreitigen Schächen hat)?
Was spricht für die alex. Texttyp (kleine MInderheit, total uneinheitlich, lokal begrenzt, nach dem 5. Jhrdt praktisch ausgestorben)?
Was spricht gegen den byz. Texttyp (absolute Mehrheit, sehr einheitlich übeliefert, große geographische Benutzung)?‚
Gottes Segen!
Hi Torsten,
hier kommt jetzt meine eigene persönliche Meinung, wobei ich natürlich nichts gegen Andersdenkende habe und mich besonders auch über Kunden freue, die eine andere Ansicht haben: Meiner Beobachtung nach hilft es nicht, das Problem als Trockenübung zu behandeln. Aus meiner eigenen Erfahrung mit der Textkritik und aus der freundschaftlichen Diskussion mit Mehrheitstext-Anhängern glaube ich: Das Hauptproblem der Mehrheitstextvertreter liegt darin, dass sie die interne Evidenz vernachlässigen und eigentlich stärkere „alexandrinische” Lesarten auf dieser Grundlage prinzipiell ausschließen.
Ein Problem ist das deshalb, weil sie den alexandrinischen Text als Strohmann bekämpfen. Die moderne Textkritik interessiert sich eigentlich viel mehr für die interne Evidenz, also die innere Logik, die erklären kann, durch welchen Fehler (oder eine gut gemeinte Korrektur) eine bestimmte Lesart entstanden ist. Dazu zeigen stemmatische Studien wie die Dissertation von Stephen Carlson zum Galaterbrief, dass es „den” alexandrinischen Typ gar nicht gibt (zumindest in den Paulusbriefen, aber ich vermute, man wird es für das ganze NT nachweisen können). Die entsprechenden Handschriften sind kaum oder nur entfernt verwandt. Als alexandrinisch sind schlicht die Handschriften bekannt, die den besten Text enthalten.
Das andere Problem: Zwar ist die Auswertung interner Evidenz an manchen Stellen recht subjektiv, z.B. wenn man danach fragt, ob an einer Stelle etwas absichtlich hinzugefügt oder versehentlich weggelassen wurde. Dennoch gibt es genügend leicht zu findende Stellen, wo die interne Evidenz schlicht gegen den byzantinischen Text spricht. Hier müssen Vertreter des Mehrheitstexts m.W. prinzipiell argumentieren, dass der Mehrheitstext der überlegene ist und daher richtig sein muss. Aber das ist letztlich zumindest teilweise ein Zirkelschluss.
Lieber Benjamin
vielen Dank für deine Antwort.
Das ist ja gerade die Frage: Enthalten die alex. Hss. wirklich den besseren Text? Warum meinst du das?
Zwar sind die etwas früheren Hss. der alex. Textlinie zeitlich gesehen einen Tucken näher an der Entstehungszeit dran als die Hss. des byz. Textes. Deshalb automatisch urtextnäher? Dies habe ich auch lange Zeit für maßgebend gehalten, bin dann aber bei der Lektüre vieler Werke zu diesem Thema und durch ausgiebige Emailkorrespondenz mit Fachleuchten der Textkritik etwas in Schwanken geraten. Frühe Hss. muss nämlich nicht bedeuten, dass der Text auch automatisch früher ist als der Text einer späteren Hss. Handschrift und der darin enthaltene Text sind zwei paar Schuhe. Eine Hss. aus dem 6. Jhrdt kann Text aus dem 2. Jhrdt transportieren und eine Hss. aus dem 4. Jhrdt Text aus dem 3. Jhrdt. Und man weiß nie, wieviele Kopierschritte vorangingen.
Außerdem sind die Hss. des alex. Texttypes so dermaßen unterschiedlich zueinander, dass die Rekonstruktion eines Grundtextes daraus ein Ping-Pong-Spiel zwischen den verschiedenen Lesarten geworden ist. Neste Aland springt fast immer von Vaticanus (B) nach Sinaiticus (Aleph/A), dh der Text ist dann BBAABABABBBAABBBABBABBAB AABBBBABABABABABABAB.. Wie will man aus so unterschiedlichen Zeugen einen Text herausfiltern? Nur an mikroskopisch geringen Stellen nimmt der NA auch mal eine Lesart aus dem byz. Text, sonst immer nur „follow Vaticanus and Sinaiticus“. Das alles hat mir sehr zu denken geben. Und tut es auch noch heute! Du, lieber Benjamin, hast das m.E. völlig richtig formuliert: Es gibt eigentlich gar keinen alex. Texttyp mit sich nahestehenden Hss. außer Vaticanus, und P75. Was von Aland als alex. Text gehandelt wird ist ein zusammengeschweißter Kunsttext und keine Textfamilie. Da hat kein Text geherrscht, weil die Schlamper da mal so, mal so kopiert haben und im übrigen viel byz. Text und Western-Text in den frühren Papyri zu finden ist. Die frühen Papyri sind ein “mixed bag”, ein “mixed texttype”. Dann bastelt man unter Auslassung der MT-Textstellen einen Text zusammen, den es nicht gab, und das wird dann als alex. Textform verkauft – m.E. Humbug. Der überlieferte Text war von Anfang an der byz. Text, der AT hat gar keine Überlieferung und er wurde zum Glück auch nicht in die Überlieferung eingespeist (es gibt außer B und P75 keine ähnlichen Hss und auch keine Nachfolge-Hss von B und Aleph!). Praktisch alle frühen Papyri kreisen um den byz. Text. Der Restanteil in den Hss, der nicht byz. Text ist, ist zum Großteil Auslassungen und Kopierfehler, also Sondergut.
Fachleute haben – das sagen selbst die NA-Only-Leute – festgestellt, dass die frühen Hss. des alex. Texttypes von Auslassungen und Kopierfehlern nur so wimmeln. Aland geht dann her uns sagt: Die Auslassungen (die man wg. Homoioteleuton oft klar erkennen kann, wenn man die alex. Hss. gegen eine byz. Hss. vergleicht) ist Original, den längeren Text haben sich die tausenden von späteren Kopisten hinzugedacht, obwohl die sich gar nicht kannten. Das das genaue Gegenteil viel wahrscheinlicher ist, wenn die Kopisten kein Griechisch konnten wie in Egypten, wird konsequent ausgeblendet. Genauso das mit der härteren Lesart. Alles, was komisch, unklar, grammatikalisch falsch klingt ist Original, die evident passende Formulierung ist Quatsch, das haben sich bestimmt tausende von Kopisten aus ganz Europa in vielen Jahrhunderten des Kopierens ohne sich zu kennen alle zufällig gemeinsam ausgedacht.
Ich sehe da kaum interne Evidenz, die auf besondere Urtextnähe des alex. Textes schließen läßt. Oder was meinst du mit interner Evidenz?
Was meinst du?
Gottes Segen!
Lieber Torsten,
nein, keine Handschrift ist nur aufgrund ihres Alters besser oder näher am Urtext. Leider wird „uns” dieses Argument von Mehrheitstext-Verfechtern gerne in den Mund gelegt, aber es gibt eigentlich niemanden, der das nur so behaupten würde. Da muss man aufpassen, dass man nicht gegen einen Strohmann kämpft. Strohmänner können sich nicht wehren und sind sehr leicht zu besiegen! 😉
Was du als Unterschiede zwischen den „alexandrinischen” Handschriften beschreibst, ist auch ein Symptom der Tatsache, dass diese Handschriften eben nicht besonders nahe verwandt sind und so keinen eigentlichen Texttyp darstellen. Was diese Handschriften gemeinsam haben, ist, dass sie tendenziell einen besseren Text enthalten, ob sie nun alt sind oder nicht (denn es gibt ja auch „alexandrinische” Hss. aus dem Mittelalter). Dieser Text zeichnet sie aus, und diesen Text versuchen Textkritiker zu rekonstruieren. Und natürlich: Auch in diesen Hss. sind viele Fehler enthalten.
Dass man sich aus verschiedenen Zeugen einen eklektischen Text zusammenstellt, ist kein Humbug, sondern methodisch absolut solide. Der Prozess zollt letztlich nur der Tatsache Respekt, dass sich beim Überlieferungsprozess Schreibfehler und Korrekturen einschleichen, die schlicht in jedem erhaltenen Zeugen zu finden sind. Viel fragwürdiger ist die Annahme, dass es doch einen Zeugen geben sollte, der keine Fehler enthält. Warum denn? Übrigens ist das im byzantinischen Text nicht anders.
Aber hier stoßen wir an die Grenzen dessen, was man allein mit einer theoretischen Diskussion erreichen kann. „Interne Evidenz” bedeutet letztlich, dass man die Lesart vorzieht, die die Entstehung der anderen am besten erklären kann. Leider polemisieren Mehrheitstext-Verfechter häufig mit einer sehr unzutreffenden Darstellung der geltenden Positionen gegen den Konsens, sodass ihre Argumentation dann in großen Teilen nicht überzeugend ist.
Die von Hort vorgelegten Kriterien dazu sind im Großen und Ganzen weiter gültig, wobei man inzwischen vom Kriterium der kürzeren Lesart viel Abstand genommen hat (auch das ist ein Vorwurf, der teils immer noch vorgebracht wird). Schon längst ist es auch nicht mehr so, dass byzantinische Lesarten per se für sekundär erachtet werden. Und ganz sicher werden byzantinische Lesarten nicht einfach ausgelassen (Vorwurf 2). Übrigens gilt in der Textkritik auch der Grundsatz, dass eine zu schwierige (weil grammatikalisch falsche oder offensichtlich auf einen Fehler zurückgehende) Lesart natürlich auch nicht automatisch die bessere ist, sondern sich bei genügend Anzeichen selbst disqualifiziert. (Vorwurf Nr. 3)
Ich habe in meinem Leben eine dreistellige Zahl von textkritischen Variationen untersucht. Nicht immer ist die Entscheidung glasklar oder einfach (oder überhaupt plausibel möglich). Aber fast immer ist es tatsächlich so, dass der Mehrheitstext schlicht und einfach auf logischer Ebene unterliegt. Es ist einfach so, dass byzantinische Lesarten zu Harmonisierungen, Aufblähungen oder Textglättungen tendieren, ohne dass deren Verfechter das im Einzelfall überzeugend erklären können. Stattdessen wird dann auf grundsätzlicher Ebene mit der byzantinischen Überlegenheit argumentiert (wobei ich mich hier eines Besseren belehren lasse). (Einige meiner Fälle lassen sich z.B. hier nachlesen, wohin sie leider aus den Fußnoten der eigentlichen Übersetzung ausgelagert worden sind.)
Hilft das?
Ich hoffe nun übrigens, dass ich hier nicht selbst einen polemischen Eindruck erwecke. Wie gesagt, ich habe viele Bekannte und natürlich auch Kunden hier, die anderer Meinung sind und die ich trotzdem schätze. 🙂 Auch dir Gottes Segen.
Lieber Benjamin,
vielen Dank für deine Antwort. Ich wollte natürlich auch nicht polemisieren, sondern nur deutlich klar machen, was mich bewegt. Und v.a.: Ich bin ja selbst noch hin- u. hergerissen zwischen dem NA und dem byz. Text! Help!
Habe ich dich richtig verstanden: Die Regeln der Textkritik, die sind es, nach denen du zu der Auffassung gelangt bist, dass der alex. Texttyp der bessere ist. Korrekt? Also lectio brevior plus prefer the harder reading etc.?
Ich hab viel darüber gelesen in der angelsächsischen Literatur, dass auch der NA noch viel von Westcott/Hort übernommen hat, nur gibt man das in Münster nicht zu. Dh im Prinzip ist NA immer noch ein Kunsttext aus 80% Vaticanus (dem „Meer der Reinheit”), 19% Sinaiticus und 1% byz. Hss. Und v.a. immer noch das sklavische Festhalten an der lectio brevior, und das trotz der von Royse in tausenden von Fällen nachgewiesenen Tendenz der frühen Kopisten in Ägypten zum Auslassen (wg. Homoiot.). Verursacht dir das gar keine Bauchschmerzen? Der NA ist im Prinzip ein Ping-Pong von B und Aleph unter extremer Präferenz für die kürzere Lesart. Ich bin selbst kein Textkritiker, habe aber genug Untersuchungen gelesen, in denen das so bestätigt wurde. Selbst Münster gibt ja in der TuT-Reihe zu, dass Hauptzeuge immer nur Vaticanus ist (Ausnahme: Offenbarung, dort Alex.).
Ich würde gerne verstehen, warum du die textkritischen Regeln wie lectio brevior etc. so überzeugend findest. Ist es nicht viel logischer, dass die ägyptischen Kopisten – dort wurde kein Griechisch gesprochen – eher ausgelassen haben? Und wg. Kopierfehlener eine schwerer verständliche Formulierung geschaffen haben (und nicht, weil sie das Original ist!)?
Stick with me, Benjamin! I keep on struggling!
P.S. Warum beteiligt sich sonst keiner in diesem Blog?
P.S. Das heißt, dass ich deiner These, dass man von der lectio brevior „viel Abstand genommen hat”, nicht zustimmen kann. Zumindest habe ich immer wieder gelesen, dass – entgegen dem Vorsatz aus Münster – diese Regeln immer noch eine der Wichtigsten ist (gibt Metzger selbst zu).
Moin Leude,
will keiner auf meinen Input antworten?
Entschuldige, ich musste es immer wieder aufschieben, weil wir zurzeit recht beschäftigt sind! Und kein Problem, ich finde es gut, dass wir das Ganze bewusst auf der Ebene eines sachlichen Austausches halten können, wie es sich gehört. 😉
Royse hat eigentlich die wesentliche Arbeit in Sachen Lectio brevior geleistet, die ist auch weithin beachtet worden. Daher habe ich in der Hinsicht keine These aufgestellt, sondern versucht, die gegenwärtige Forschungsmeinung dazu zu repräsentieren. Daher ignoriere ich selbst die lectio brevior als Kriterium eigentlich meist – ich finde es viel hilfreicher danach zu suchen, welche Lesart die Entstehung der anderen erklären kann. (Allerdings habe ich auch gelesen, dass Royse eigentlich nicht viel anderes sagt als Hort, der die lectio brevior offenbar mit einem recht strengen Regelkorsett versehen hat. Ich vermute, auch der hat das Kriterium weise eingesetzt.)
Aber um auf deine Frage nach den Kriterien einzugehen: Letztlich geht es dabei immer um den Vergleich von Lesarten und die Frage, welche Lesart die Entstehung der anderen erklären kann. Hier kann man eigentlich immer nur nach Wahrscheinlichkeiten gehen, und es gibt ganz sicher Fälle, die aller Wahrscheinlichkeit trotzen. Die zweifelhafte Qualität des byzantinischen Texts zeigt sich aber nicht an Stellen, wo man sowohl für eine Hinzufügung als auch für eine Auslassung einer längeren Lesart argumentieren kann. Sie zeigt sich an den vielen Stellen, wo byzantinische Lesarten zwei andere Lesarten zu einer längeren kombinieren (ein häufiges Muster) oder wo sie eine Formulierung an eine andere angleichen, z.B. in den Evangelien häufig an Parallelstellen im Matthäusevangelium, etc. Zur Frage nach den Griechisch-Kenntnissen der ägyptischen Schreiber kann ich nicht viel beisteuern, ich vermute aber, dass das ein stark vereinfachtes und zu paradigmatisch postuliertes Argument ist, das sich in den historischen Tatsachen nur bedingt wiederspiegeln wird. Dazu kommt, dass Sprach-Kenntnisse nicht unbedingt nötig sind, um einen Text zuverlässig abzuschreiben. Daher würde ich es ebenso vorsichtig einsetzen wie die lectio brevior.
Die deutsche Textkritik ist nach meinem Eindruck außergewöhnlich gut mit der angelsächsischen Forschung vernetzt. Nestle-Aland ist ja schon länger ein internationales Projekt, auch die Editio Critica Maior (ECM) oder die Coherence-based Geneological Method (CBGM) mögen in Münster angeleitet werden, aber unter internationaler Beteiligung. Der oben erwähnte Carlson hat z.B. letztlich auf Basis der Münsteraner CBGM gearbeitet.
Gleichzeitig muss man sehen, dass der NA-Text seit den siebziger Jahren (?) nicht mehr wesentlich verändert worden ist. Man wartet hier die Ergebnisse der per Stemma-Forschung (CBGM) ermittelten ECM ab und überführt dann die Vorschläge in den Text, wie es jetzt schon in den katholischen Briefen geschehen ist. Das geht manchen zu langsam und führt auch dazu, dass der Text natürlich nicht als unfehlbar anzusehen ist. So gibt es denn auch wenige Exegeten oder Bibelübersetzer, die dem Text einfach folgen. Und es gibt einzelne Neutestamentler, die ihn sogar schlecht finden (wobei sie in solchen Fällen dann erfahrungsgemäß nicht auf dem neusten Stand der textkritischen Forschung sind). Als Folge entstehen jetzt alternative Editionen wie das SBLGNT oder das THEGNT.
Nach meiner eigenen Einschätzung ist NA meist zuverlässig, aber ich komme vielleicht an einer von 9 Stellen zu einer anderen Meinung. Ich denke aber, dass mit Vollkollation und der stemmatischen Methode der CBGM maßgebliche Fortschritte möglich sind. Die gleichzeitig häufig zeigen, dass die vorher geleistete Arbeit erstaunlich gut war.
Hi Benjamin,
vielen Dank. Dh für dich sind diese internen Kriterien der Textkritik der entscheidende Punkt, warum du zum NA neigst und nicht zum byz. Texttyp. Das kann ich gut nachvollziehen.
Aber: Wie erklärst du dir dann, wie der byz. Text entstanden ist? Haben ab dem 5. Jhrdt auf einmal an ganz vielen unterschiedlichen Orten Kopisten, die sich nicht kannten, auf wundersame Weise praktisch immer an denselben Stellen Text hinzugefügt? Und das über viele Jahrhunderte? Ist das nicht komplett unwahrscheinlich?
Dieser letzte Punkt gibt mir bei der Textdebatte immer zu denken.
Wie erklärst du dir dann das Aufkommen und die Harmonie im byz. Text, wenn doch der frühe Text (im wesentlichen alex.) der Urtext wäre?
Good bless!
Torsten
Eine gute Frage an jemanden, der behauptet hat, ausschlaggebend wäre, welche Variante die Entstehung der anderen erklären kann. 😉 Ich bin in der Hinsicht nicht ganz firm, aber die Forschung scheint zu zeigen, dass der byzantinische Text kein geplantes Produkt ist. Auch im Mehrheitstext lassen sich nämlich im breiten Handschriftenstrom keine klaren Verwandtschaften abzeichnen. Auch byzantinische Lesarten treten uneinheitlich und mit großer Streuung auf, und der „reinere” byzantinische Text ist tendenziell jünger als weniger reine Handschriften. (Münster analysiert die Handschriften ja sogar auf „byzantinische Kontaminierung” hin.) All das weist auf eine graduelle, unsystematische Entwicklung hin, die sich irgendwann mehr und mehr zu einem Texttyp verdichtet hat. (Mich würde dagegen interessieren, wie Mehrheitstextbefürworter das erklären.)
Der Texttyp entstand demnach nach und nach, m.W. eher aus der Tendenz, stilistisch unschöne oder aus anderen Gründen verbesserungswürdige Lesarten zu verbessern. Wo Griechisch weiter gesprochen und als literarische Sprache behandelt wurde, da ergab sich gerade bei gebildeten Schreibern das Anliegen, den Bibeltext zu bewahren und zu pflegen. Nach meinem Verständnis wäre das Anliegen dann weniger gewesen, den ursprünglichsten Text zu bewahren, sondern den „besten”, ob das jetzt um den Stil geht, um die Harmonisierung mit anderen Bibelstellen oder um die Harmonisierung abweichender früherer Lesarten durch Kombination beider. Wenn so etwas an vielen tausend Stellen unsystematisch, aber nach einem konsistenten Muster geschieht, wirkt sich das unweigerlich auf den in diesem „Klima” überlieferten Texttyp aus. Für mich ist das eine edle Gesinnung, die sicher auch Segen gebracht hat, uns aber leider vom ursprünglicheren Text fortgebracht hat.
(Allerdings: Kann man immer klar sagen, an welcher Stelle unglatter Text verbessert und an welcher eine glatte Lesart korrumpiert worden ist? Vermutlich nicht, wie ich ja schon angedeutet habe. Aber ist es nicht intrinsisch wahrscheinlicher, dass ein in „verbesserungswürdigem” Volksgriechisch geschriebener Text mit der Zeit von stilbewussten Lesern verbessert wird, als dass ein eleganter Text in fast schon systematischer Manier (aber dennoch in der Praxiss ganz unsystematisch) stümperhaft entstellt wird?)
Das Anliegen, einen einheitlichen Text zu bewahren, wäre im Fall des MT gar nicht so unterschiedlich von dem der Masoreten – nur dass die sich nicht getraut haben, in ihren hebräischen Text einzugreifen. Ihre Korrekturen haben sie als Lese-Anweisungen an den Rand geschrieben (Masora).
Es sei mir übrigens ferne, dir meine Meinung aufzudrängen. Ich hoffe, du fühlst dich von mir nicht niedergeredet, sondern ich helfe dir wirklich weiter. Ich kann die Attraktion der anderen Seite gut verstehen…
Gottes Segen,
Benjamin
Danke, Benjamin.
Deine Theorie setzt aber die Annahme voraus, dass zufällig eine große Zahl von Kopisten immer wieder dieselbe Tendenz zur Glättung, Harmonisierung etc. hatten, ohne dass das zentral gelenkt wurde. Der byz. Text mag eine Entwicklung gemacht haben, bis er sich verfestigte, aber die im Vgl. zum alex. Texttyp wesentlich geringere Differenzen unter den Hss. sind ja enorm und der Text war ja schon am Anfang stabil. Auch wenn er nach und nach „noch stabiler” wurde, wie kann das alles sein? Alles Zufall? Ist es da nicht viel wahrscheinlicher, dass der alex. Texttyp ausgelassen hat?
Es gab keine gemeinsame Instanz, die alles hätte steuern können. Kopisten haben auch keine gemeinsame Kongresse abgehalten. Diese Prozesstheorie dient m.E. dazu, um NA schönzureden: Die haben Text weg, z.B. Alexandrinus an etlichen Stellen und nur die byz. Hss. und alle anderen haben das, also: der ganze Rest hat sich abgesprochen und das gemeinsam ergänzt oder per Zufall haben das Tausende Kopisten ergänzt. Andersrum wird es doch viel logischer. Der Urtext war der längere, durch Kopierfehler ist Text abhandengekommen. Stattdessen wird ein (viel wahrscheinlicherer) Kopierfehler zum Original erhoben und dann die unglaublich unwahrscheinliche Variante aus dem Hut gezaubert, dass sich in ganz Europa an tausenden Stellen zufällig die Kopisten dieselben SAchen ausgedacht habe.
Ich bin KEIN Textforscher, sondern Jurist. DAher bin ich logisches Denken gewohnt. Und diese Prozesstheorie ist definitiv unwahrscheinlich.
Also um das klar zu stellen: Niemand geht (mehr) von einem zentralen byzantinischen Entstehungsprozess aus. Es gibt ja tausende bis zehntausende relevante Stellen. Aber überleg mal: Wenn du auf guten Stil Wert legst und der Meinung bist, ein Text wäre korrekturbedürftig, dann verbesserst du den. Wenn dann der nächste kommt und eine Art Textkritik macht, indem er zwei Handschriften mit unterschiedlichem Text vergleichst, wirst er den Text mit dem besseren Stil vorziehen. Die stilistisch schlechte Lesart fällt raus und stirbt aus, die glättere überlebt. Der Schreiber ist der Meinung, sich gut um den Text gekümmert zu haben.
Auch wenn du hundert Leute hast, die alle besseren Stil bevorzugen, werden die immer den besseren Stil vorziehen. Die müssen sich gar nicht absprechen, es reicht, dass sie ein ähnliches Stilempfinden haben und sich nicht scheuen, zu verbessern bzw. „schlechtere” Lesarten auszusortieren. Diese Leute arbeiten dann auf der Grundlage von Handschriften ihrer Vorgänger, die genauso gedacht haben. In der nächsten Generation sind dann nur diese Handschriften bekannt und weitere (mit weiteren Verbesserungen) kommen hinzu. Der Prozess ist eine Art umgekehrte Textkritik, denn es soll nicht der ursprünglichste, sondern der aus anderen Gesichtspunkten beste Text überliefert werden, und wie dieser aussehen würde, darüber herrscht ein milieu-bedingter Grundkonsens.
Auf diese Weise kann ein einzelner Kopist eine neue Lesart als Verbesserung einführen, die ein anderer, der seinen Text dann liest, als die besserere identifiziert und überliefert. Wenn dieser andere und hunderte weitere das dann an hundert oder tausend Stellen nicht systematisch, aber nach und nach und natürlich unter gegenseitiger Inspiration tun (je verbreiteter eine Lesart, desto wahrscheinlicher setzt sie sich durch), bekommst du nach einigen hundert Jahren, über etliche Textgenerationen hinweg, unvermeidlich einen Text, der an hunderten Stellen mehr oder weniger einheitlich korrigiert ist. Das ist für mich in dieser Form völlig plausibel.
Zum alexandrinischen Texttyp solltest du deine Argumentation überprüfen:
1) Wir hatten uns schon darauf verständigt, dass die Handschriften kaum verwandt sind. (Was ihre Unabhängigkeit erweist.) Das zeigen stemmatische Forschungen zumindest an den Paulusbriefen.
2) Die übliche Mehrheitstext-Argumentation gegen den „alexandrinischen” Text ist, dass schlecht übertragene Texte aussortiert und weggeworfen worden sind. Das verträgt sich gerade noch mit 1), bringt aber seine eigenen logischen Probleme mit sich.
3) Jetzt stellst du es so dar, dass der Texttyp insgesamt Fehler gemacht hat, wodurch Lesarten weggefallen sind, aber ich bin sicher, du hast eher 2) im Sinn.
Mir fehlt dazu noch eine kohärente Hypothese. Wenn schlechte Texte aussortiert werden, wie kann daraus dann doch ein erkennbar unterschiedlicher Handschriftenstrom entstehen? Wie können dutzende von Texten ähnliche Lesarten bezeugen? Nur, wenn diese Texte selbst kopiert und für gut befunden worden sind. (Wir sehen das z.B. bei Kirchenvätern, die in der legendären Bibliothek von Cäsarea ihre eigene Textkritik betrieben.)
Und überleg dir das noch einmal sehr gut: Wenn die aus meiner Sicht besten Texte nicht miteinander verwandt sind (eine These, die man aus deiner Sicht so übernehmen kann), dann zeigt das, dass diese Texte unabhängig sind. Diese Texte sind so wenig miteinander verwandt, dass ihr nächster gemeinsamer Vorfahre häufig der Urtext ist. Wenn ich nichts übersehe, dann ist die Tatsache, dass sie trotz allem erkennbar ähnliche Lesarten überliefern, ein zwingender Beweis dafür, dass diese Lesarten ursprünglicher sind.
Eine weitere logische Schwäche lässt sich an 2) ausmachen: Warum sind diese weggeworfenen „schlechten” Texte erhalten geblieben, während die vorgeblich gebrauchten und kopierten (und dann genauso, aber viel zahlreicher weggeworfenen) byzantinischen Texte es nicht sind? Letztlich können Mehrheitstext-Verfechter also nicht überzeugend begründen, warum unter unseren ältesten Handschriften nicht mehr byzantinische sind, wenn dieser Texttyp denn wirklich der ursprünglichste sein sollte.
Auch bzgl. Nestle-Aland hast du ohne konkrete Belege eine sehr negative Meinung. Es ist nichts grundsätzlich Verkehrtes daran, dass der Text gewissen Handschriften öfter folgt. Im Gegenteil zeigen viele hundert Einzelfälle und auch die neuere Textforschung, dass die Methode zuverlässig ist. (Übrigens wird die stemmatische Forschung, aus der mein obiger Beweis stammt, von Mehrheitstext-Verfechtern noch gar nicht rezipiert.)
Womit du bei NA eigentlich ein Problem hast (so vermute ich), ist nicht die Methode, sondern dass er eklektisch und nicht diplomatisch ist, d.h. dass er nicht einem Haupttext folgt, sondern Lesarten aus vielen zusammensucht. Aber das ist in einem komplexen Überlieferungsprozess wie dem des NT nur zu erwarten und – wie gesagt – ja auch in einer kritischen Edition des byzantinischen Texts nicht anders.
Lieber Benjamin,
herzlichen Dank für deinen Input.
Ich habe mich vielleicht etwas unscharf ausgedrückt: Mit meiner vorherigen Mail wollte ich zum Ausdruck bringen, dass sowohl die Rezensionshypothese (vertritt in der Tat heute keiner mehr, du ja auch nicht) ALS AUCH die von dir vertretene „Entwicklungs-Hypothese” – dh es gab keine zentrale Steuerung, die Kopisten haben alle aber über viele Jhrdt hinweg den Text immer weiter geglättet, ohne sich zu kennen – unwahrscheinlich ist. Die von dir vertretene „der-Text-hat-sich-entwickelt-Annahme” setzt ja voraus, dass es am Anfang Hss. gibt, wo nur ein bißchen byz. Text drin ist, dann ein paar Jahre später ein bißchen mehr, dann wieder mehr usw. usw. Das behaupten ja auch Heide und Wachtel.
Das nachzuweisen hat aber noch kein NA-Mensch geschafft. Ich habe die von mir gelesene Lit. so verstanden, dass die byz. Hss. aus dem byz. Reich und dem Rest von Europa schon von Anfang an extrem homogen waren. Wie kann das sein? Nur die in Ägypten gefundenen Hss. mit byz. LA (Alexandrinus, W, P66 etc.) waren Mischmasch, die aus Byzanz waren gleich homogen.
Quote:
2) Die übliche Mehrheitstext-Argumentation gegen den „alexandrinischen” Text ist, dass schlecht übertragene Texte aussortiert und weggeworfen worden sind. Das verträgt sich gerade noch mit 1), bringt aber seine eigenen logischen Probleme mit sich.
3) Jetzt stellst du es so dar, dass der Texttyp insgesamt Fehler gemacht hat, wodurch Lesarten weggefallen sind, aber ich bin sicher, du hast eher 2) im Sinn.
Antwort:
Das habe ich so nie gesagt mit dem Aussortieren und Wegwerfen. M.E. gibt es deshalb von den byz. Hss. keine noch früheren aufgrund der klimatischen Verhältnisse und der diversen Christenverfolgungen im byz. Reich. Von anderen antiken Hss. gibt es aus den ersten 8 Jhrdt ja auch nur extremst wenig. Da ist es fast schon ein Wunder, dass es überhaupt welche gibt. Dass die frühen aus Ägypten kommen ist doch klar (hss.-freundliches Klima), dass aber bereits ca. 100 Jahre NACH den NA-Kronjuwelen Aleph und B die ersten byz. Hss. anfangen ab dem 5. Jhrdt ist da fast schon ein Wunder!
Und: Ja, soweit ich Royse, Pickering, Colwell, Robinson, Wilson, Hernandez etc. verstehe, haben die alex. Hss. Auslassungen u. Fehler ohne Ende, weil es für die Kopisten dort schwierig war, eine fremde Sprache zu kopieren. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der kurze Text genau deshalb entstanden ist als die Gegenannahme, dass sich auf wundersame Weise alle anderen den längeren Text ausgedacht haben, ohne sich zu kennen? Und das überall in Europa?
Benjamin, ich hab nochwas .-)
Wie kann es sein, dass in den ante nicene church fathers (ANF) so viele Funde von byz. LA zu finden sind? Ich weiß, dass das Standard-Argument von Wallace und Fee ist, dass das alles Quatsch ist, weil man „textkritische“ Ausgaben der ANF benutzen müsse, und dann wäre das anders. Oha! Natürlich wäre es anders, wenn man bei den Zitaten alle byz. LA rausnimmt und sagt, so, jetzt sind die nicht mehr drin.. guck, die haben gar keine byz. LA. Natürlich nicht, wenn man die alle rausstreicht und sagt „das ist jetzt die aktuelle Version der Kirchenväterzitate!!! Aber das ist ein Zirkelargument. Von allen Seiten kann man Nachweise finden, dass ANF byz. LA haben (neben alex. und western LA natürlich).
Die byz. LA in den ANF sind zwar nicht in der Mehrheit, aber wenn der byz. Text erst nach dem 4 Jhrdt geschaffen wurden, dann dürfte ja eigentlich KEIN EINZIGER Kirchenvater byz. LA haben.
Wie kann das sein?
Bsp für byz. LA bei den ANF:
Polykarp lebte von 70 bis 156 nach Christus und war Bischof von Smyrna und Schüler des Apostels Johannes. In der Kirchengeschichte des Eusebius wird von dessen Märtyrertod um 156 berichtet. Da er Zeitgenosse der Apostel war, ist anzunehmen, dass er entweder Zugang zu den Originalschriften hatte oder Kopien besaß, die unmittelbar von diesen angefertigt wurden. Im Brief an die Philipper, der etwa um 135 verfasst wurde, zitiert Polykarp etwa 60 Stellen aus dem Neuen Testament, über die Hälfte davon aus den Paulusbriefen. Stellen, an denen der kritische Text von Nestle/Aland vom Mehrheitstext abweicht, zeigen, welcher griechischen Textvorlage Polykarp folgt. In Kapitel 6,2 zitiert Polykarp Römer 14,10 gemäß dem Mehrheitstext mit „Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen“. Der kritische Text liest an dieser Stelle „Richterstuhl Gottes“. In Kapitel 7,1 führt er ein Zitat aus 1.Johannes 4,3 an: „Denn jeder, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist ein Antichrist“. Die ägyptischen Handschriften, auf die sich der kritische Text bezieht, lässt hier „im Fleisch gekommen“ aus. Ein weiteres Zitat, das Polykarp wörtlich anführt, stammt aus Galater 4,26. Hier liest der kritische Text „diese ist unsere Mutter“. Im Mehrheitstext dagegen lautet die Stelle „diese ist unser aller Mutter“. Genau diese Lesart zitiert Polykarp in Kapitel 3,1. Es ist somit einsichtig, dass Polykarp an vielen neutestamentlichen Stellen, die er in seinem Brief zitiert, der Mehrheitslesart folgt.
Zeugnisse der Kirchenväter in Bezug auf Johannes 3:13:
Hippolyt (170–235) zitiert wörtlich inkl. „ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ“ {hO WN EN TW OURANW}
Contra Haeresin Noeti (4.9.4.)
Epiphanius (315–403) zitiert zwei Mal wörtlich „ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ“ {hO WN EN TW OURANW}
Haer. (2.353.21; 015.481.25)
Anthanasius (298- 373) zitiert ein Mal wörtlich inkl. „ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ“ {hO WN EN TW OURANW}
Werk Nr. 054 26.1224.23
Basilius (303–379) zitiert nur das Ende des Verses „ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ“ {hO WN EN TW OURANW}
Werk Nr. 01929.677.41
Chrysostomos (344–407) zitiert den Vers vier Mal wörtlich und einmal mit „es steht geschrieben” inkl. „ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ“ {hO WN EN TW OURANW}
Werk Nr. 152/209
Didymus (310–398) ganz wörtlich inkl. „ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ“ {O WN EN TW OURANW}
Werk Nr. 043 (39.852.25)
Mark 1:1–2
“As it is written in the prophets…”
Irenaeus (130–202 A.D.) said this: „Mark does thus commence his Gospel narrative The beginning of the Gospel of Jesus, Christ, the Son of God, as it is written in the prophets.… Plainly does, the commencement of the Gospel quote the words of the holy prophets, and point out Him.., whom they confessed as God and Lord. ” (Against Heresies III: 10:5, :11:4, :16:3)
Mark 16:9–20 (long ending of TR)
Irenaeus (130–202 A.D.): „Also towards the conclusion of his Gospel, Mark says: So then, after the Lord Jesus had spoken to them., He was received up into heaven, and sitteth on the right hand of God.” (Against Heresies 111:10:6)
Das sind nur ein paar Bps, es gibt ja noch viel viel mehr.
wie ist das möglich, wenn der byz. Text erst später geschaffen wurden?
Ich bitte um eine Antwort!
Hab ich dich sprachlos gemacht, Benjamin? .-) Warum diskutiert eigentlich sonst keiner mit?
Also, ich komme über 2 Punkte intellektuell nicht hinweg:
1. Es gibt viele Zitate der ANF, die byz. LA haben. Von irgendwo her müssen die ja kommen. Moorman hat die zB alle aufgelistet, da wird einem ganz schwindelig. Polycarp ist voll mit byz. LA! Irenäus auch.
2. Das der byz. Text wie bei der Evolution wie ein Prozess „zufällig” entstanden ist – dein letzter Beitrag – finde ich höchst unwahrscheinlich. Sonst müsste man an eine weltweite Verschwörungstheorie zur Fälschung von Gottes Wort in Form von Hinzufügungen glauben. Und dazu gibt es keinen Beweis. Hauptskriptorien gab es am Anfang gar nicht, die Versammlungen und Christen etc. am Anfang hatten so was nicht – war ja dezentral, jeder konnte kopieren und sternförmig ging das NT in die ganze Welt. Das Hinzufügen war ja auch nie die Aufgabe von Kopisten; die sollten nur Abschreiben….und dann ohne Absprache etwas gemeinsam reinflicken, was nicht da stand? Außerdem hatten die Kopisten ein geistliches Eigeninteresse am Original und nicht an Fälschungen. Zudem gibt es ja nicht nur angebliche Harmonisierungsstellen oder sprachliche Glättungen, sondern der MT hat ja auch Stellen, wo es gar keine Parallelstellen gibt. Wie sollen die denn nachträglich unisone reingerutscht sein? Also das Szenario ist so unrealistisch, nämlich, dass man 99,9 Prozent der Kopisten als Fälscher bezeichnet, die Text erfunden haben, nur um einige frühe Hss. mit stark unterschiedlichem Text (vgl. 3.000 Unteschiede zw. Aleph und B, so Hoskier) gutzureden – damit stellt man doch jede Vernunft auf den Kopf und glaubt Sachen, die man im realen Leben nie eine Sekunde glauben würde.
Es gibt gute Argumente für das Abstellen auf den alex. Texttyp (so, wie es NA ja macht). Aber solange die beiden obigen Punkte nicht vernünftig bedient werden, leuchtet mir das nicht ein. Und zu beiden finde ich in der Literatur und im Netz nichts Gescheites, deshalb bin ich hier.
Schade, dass nur du mitmachst, lieber Benjamin. Und leider seit 1 Woche bin ich der einsame Rufer im Wald. Hört mich keiner?
Der Byzantinische Text ist der ursprünliche, richtige Text. Pickering und Robinson/Pierpont sind einleuchtend.
Es hat nie eine kirchliche Rezension des NT gegeben. Die Behauptung von Westcott & und Hort ist ein Mythos ohne geschichtliche Grundlage!
Die Prozess-Theorie: Im Lauf der Zeit wurden die Manuskripte immer mehr angeglichen.
Mathematisch gesehen ist das Unsinn!!
Ohne zentrale Rezension, können sich Texte nicht
allmählich angleichen. Sie werden vielmehr mehr und mehr divergieren! Es gibt kein mathematisches Modell, das zeigen könnte, dass ein solcher Prozess stattfinden könnte!
Mathematische Untersuchungen mit Hilfe der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigen, dass die richtige Lesart aus dem Urtext immer in einem Mehrheitstext zu finden sein wird.
Theologisch betrachtet ist es ebenso logisch. Gott hat im Mehrheitstext sein Wort bewahrt genauso wie es geschrieben steht.
Wenn man genau die „neueren Bibeln”(W/H bzw. NA(ist im Grunde W/H da hauptsächlich zwei bestimmte Schriftzeugen genutzt werden)) mit z.B. KJV /LU 1912 /Schlachter2000 vergleicht, kann man die Tendenz sehen wie Gottes Wort angegriffen wird mit bewussten Auslassungen gerade an den Stellen die unseren Herrn Jesus Christus betreffen, es ist kein Zufall.
Lieber Benjamin,
das wäre super, wenn du mir antworten könntest. I am struggling!
Was sagst du zu meinen beiden letzten Punkten? Nix?
Ich möchte gerne, finde aber die Zeit nicht! Bitte hab Verständnis dafür, dass es möglicherweise noch etwas dauert. 🙂
Ok, dann lassen wir es.
Kein anderer diskutiert mit, was ich irgendwie bezeichnend finde bei dem Thema. Und auch traurig, denn es geht doch jeden an! Wir müssen doch wissen, welcher Grundtext GOTTES Wort am ehesten entspricht. Folgen wir einfach Münster wie die Lämmer?
Ich bin immer noch der Auffassung, dass die internen Kriterien der Textkritik zwar schön klingen, letzten Endes aber auf logischer Ebene anderen Punkten, die ich hier ausführlich beschrieben habe, unterliegen bzw. diese nicht zufriedenstellend erklären können.
Gottes Segen!
Jetzt habe ich endlich Zeit, falls du noch mitliest, und falls nicht, ist es auch gut.
Zu deinem Text vom 22. September: Deine Einwände zur Entstehung der Texttypen gestehe ich dir gerne größtenteils zu, ich beanspruche ja auch nicht, das genau zu wissen, und habe im zweiten Fall schlicht extrapoliert.
Ich will aber zweierlei festhalten: Was ich zum byzantinischen Text beschreibe, ist aus zwei Gründen plausibel.
1. haben wir eben nur späte Handschriften, d.h. es gab genug Zeit für den Texttyp, um sich langsam zu entwickeln. Auch hier kann man vermuten, dass später als minderwertig angesehene Hss aus dem byzantinischen Frühstadium eher nicht erhalten geblieben sind, davon zeugen mehrere Exemplare, die auf den byz. Text hin korrigiert worden sind.
2. ist ja bei Aland für die Handschriftenkategorien der byzantinische Einfluss ausschlaggebend (wenn auch methodologisch vielleicht nicht ganz sauber). Dass man Hss so kategorisieren kann, zeigt ja schon, dass man nicht einfach sagen kann, dass der Texttyp so homogen ist, wie du es darstellst.
Schließlich zu den ägyptischen Kopisten:
1. Könntest du mir mal detailliert erklären, inwiefern ein Abschreiber schlechtere Arbeit leisten sollte, weil er eine Sprache nicht beherrscht? Es mag im Einzelfall sicherlich zutreffen, aber ich glaube nicht, dass man hier mehr als Tendenzen formulieren, aber schon gar keine Entstehungshypothese für einen ganzen Texttyp daraus herleiten kann, und der Befund passt auch einfach nicht zu dieser Vorstellung.
2. Und könntest du mir zudem erklären, woher wir überhaupt wissen können, dass die Kopisten des alexandrinischen Typs alle kein Griechisch konnten? All das ist Konjektur und methodisch fragwürdig, unter anderem, weil der Befund eine andere Sprache spricht. Übrigens ist der alexandrinische Texttyp m.W. gar nicht kürzer als der byzantinische.
Lass mich schnell den 27. September einfügen, bevor wir zum 25. zurückkommen:
1. Nein, die Kopisten hatten kein Interesse am Originaltext, sondern sie hatten ein Interesse am besten Text. Deshalb haben sie wahrgenommene Fehler vielfach ausgebessert, und wenn es nur stilistisch unsauberer Text war. Das ist insgesamt übrigens eine so gut belegte Tatsache, dass es aus Sicht der byzantinischen Priorität sehr gewagt wäre, sie nicht zu berücksichtigen. D.h. wer realistisch ist, muss zugestehen können, dass der byzantinische Text wenigstens stellenweise gut gemeinte Korrekturen enthält und sekundär ist. Was sich übrigens ja mit dem Befund deckt.
2. Es geht dabei aber nicht darum, dass sie den Text gefälscht haben. In dieser Hinsicht solltest du vielleicht tatsächlich etwas über scribal habits lesen, darunter auch Attizismen – ein guter Teil der MT-Lesarten lässt sich nämlich hervorragend so erklären. Hier habe ich das Gefühl, dass du die Argumentation der „Gegenseite” schon so gut verinnerlicht hast, dass du sie dafür kritisieren kannst. Denn deine Kritik in dieser Sache ist haltlos. Richtig verstanden, ist die Textverbesserung aufgrund bestimmter Auffassungen und Schreibgewohnheiten nämlich ein logischer und plausibler Prozess. Hier würde ich dich wieder dazu ermuntern, Kommentare zu lesen, die textkritische Zweifelsfälle zugunsten NA lösen, Wieland Willker ist z.B. eine wirklich exzellente Ressource. http://www.willker.de/wie/TCG/
3. Es geht hierbei auch, das habe ich wiederholt betont, nicht um ein Gutreden von Vaticanus und Sinaiticus. Es ist doch klar, dass darin auch Fehler und Unterschiede enthalten sind. Allerdings: Bei byzantinischen Handschriften ist es genauso, auch da gibt es in weiten Teilen große Unterschiede. Der Texttyp ist nur in seiner Tendenz zu Glättungen homogen. Es geht letztlich um interne Faktoren, und es sind diese, die du z.B. bei Willker wunderbar in der Praxis demonstriert bekommen kannst.
Zum 25. September: Ich kenne die Argumentation zu den Kirchenvätern nicht, auf die du dich beziehst. Aber ich glaube nicht, dass die apostolischen und frühen Kirchenväter argumentativ ausreichen, um eine frühere Verbreitung des Mehrheitstexts zu belegen.
1. Viele byzantinische Lesarten sind früh entstanden, und etliche sind nach internen Kriterien ursprünglich. Vielleicht zeigen die Kirchenväterzitate ja sogar stellenweise gerade auch, dass Textkritiker sie als Quellen vernachlässigt haben und dass die enthaltenen Lesarten vielleicht doch höher zu gewichten sind.
2. Manche der Stellen, die du zitierst, sind gar nicht genuin byzantinisch.
Ich kenne nur die beiden Markusstellen genauer, aber dein Zitat aus Markus 1,2 ist auch in anderen Texttypen bezeugt. In diesem Fall ist die interne Evidenz übrigens stark aufseiten NA, denn es ist viel plausibler, dass jemand den Text korrigiert, um eine nicht ganz korrekte Zuschreibung an Jesaja zu korrigieren, als dass jemand den Text im Nachhinein und nur halbwegs korrekt Jesaja zuschreibt. Natürlich hat sich die präzisere Lesart weiter verbreitet. (Die andere byzantinisch bezeugte Lesart in Mk 1,1, „Sohn Gottes”, ist offenbar ebenfalls ursprünglich, aber hier ist die interne Evidenz neutral und die externe deutlich stärker.)
Der Markusschluss ist ein Fall, der sich meines Erachtens mit den normalen Mitteln der Textkritik nicht abschließend lösen lässt. Es lässt sich hier m.W. nur seriös sagen, dass wir in der Überlieferungsgeschichte Anzeichen dafür sehen können, dass seine Echtheit angezweifelt wurde. Aber auch hier handelt es sich nicht um eine byzantinische, sondern eher um eine breit bezeugte nicht-alexandrinische Lesart.
Ich glaube, auch in dieser Frage liegt das Problem in der Argumentation, denn sie bekämpft letztlich einen Strohmann: Dass der Mehrheitstext nach dem 4. Jh. geschaffen wurde, wie du schreibst. Aber das vertrete ich nicht und ich glaube auch nicht, dass Münster das tun würde.
Lieber Benjamin,
vielen Dank für deine Mühe!
zu deiner ersten 1.
Auch vom byz. Text gibt es sehr frühe Hss., Kodex A und W haben viel byz. Text. Von beiden Textfamilien sind daher frühe Hss. da, zwischen den „Kronjuwelen” aus Münster (Aleph und B) und den ersten Hss. mit mehr byz. LA liegen nur ca. 50–70 Jahre. Praktisch sofort nach den AT-Funden fangen die MT-Hss. an. Das ist Wahnsinn wenn man bedenkt, dass es zu fast allen antiken Werken erst viel viel später die ersten Kopien gibt. Dh eigentlich müssen wir nur zwischen 2 SEHR früh bezeugten Textfamilien untescheiden.
zu deinem ersten Punkt 2:
„bei Aland für die Handschriftenkategorien der byzantinische Einfluss ausschlaggeben”.. ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst. Im NA wird der byz. Text mehr oder weniger in die Fußnoten verbannt, man springt von Aleph zu B und wieder zurück. An ganz wenigen Stellen daraf dann auch mal eine byz. LA in den Haupttext, um den Schein einer Abwägung zu wahren. Zählen tut der MT nicht. Gibt Aland ja selbst zu, dass der MT für die Textkritik „ausscheidet” (so ähnlich at er das formuliert).
zu deinem zweiten Punkt 1 und 2 (zu den ägyptischen Kopisten)
„Könntest du mir mal detailliert erklären, inwiefern ein Abschreiber schlechtere Arbeit leisten sollte, weil er eine Sprache nicht beherrscht?”
Hä? Liegt das nicht irgendwie auf der Hand? Lass mal einen Ägypter ein Diktat auf Deutsch machen. Was kommt dabei raus? Ein klasse Text? In den ägyptischen Hss. gibt es zig Kopierfehler, meistens Sprünge nach vorn (das weißt das ja!). Viele Wörter werden durch homoiot. ausgelassen. Das alles würde nicht passieren, wenn man die Sprache besser beherrscht, weil man dann sieht, dass der Satz unvollständig ist und wo man wieder weiterkopieren muss, anstatt dort weiterzuachen, wo man mit dem Auge hinspringt. Schau mal
zu Scribal errors (mostly omissions)
http://textualcriticism.scienceontheweb.net/TEXT/Errors.html
zu homoioteleuton
http://homoioteleuton.blogspot.de/
Da wird dir ganz schwindelig. Ob die alle griechisch konnten oder nicht weiß ich ja auch nicht, aber beim Kopieren sind denen so viele Fehler unterlaufen, dass man vermuten kann, dass ihr Gr. zumindest nicht gut war. Und wenn mann dann ständig Kopierfehler macht uns Wörter und ganze Sätze rausläßt, dann ensteht schlicht und einfach ein anderer Text.
Im Sinaiticus
• gibt es fast 1.500 Singulärlesarten allein in den Evangelien, die keine andere Hss. als nur Sinaiticus aufweist.
• Buchstaben und Wörter, sogar ganze Sätze werden ständig doppelt geschrieben oder angefangen und sofort wieder beendet.
• Beinahe auf jeder Seite gibt es Korrekturen, die von bis zu 10 Schreibern durchgeführt wurden. Einige dieser Korrekturen wurden bereits bei der Herstellung gemacht wobei andere erst im 6. oder 7. Jahrhundert durchgeführt wurden.
Beim Vaticanus
• sind es ca. 590 Singulärlesarten.
• Auch Vaticanus zeigt zahlreiche Stellen, an denen der Schreiber das gleiche Wort oder den gleichen Satz zweimal wiederholt.
Die literarische Qualität beider Hss. ist daher in höchstem Maße zweifelhaft, die Kopisten waren schlicht und einfach nicht sorgfältig und/oder nicht fähig! In praktischem jedem Vers in den Evangelien unterscheiden sich beide Kodizes. Und diesen zwei Kodizes gibt der NA im Zweifel Vorrang vor über 5.300 Hss., die übereinstimmend anders sind und unstreitig eine wesentlich höhere Texthomogenität haben! Auch wenn diese frühen Kodizes zeitlich näher an der Entstehung der Originale sind, so führen die vielen Fehler in den Hss. dazu, dass die Vertrauenswürdigkeit der Hss. zweifehlhaft ist. Wenn man bestimmte Passagen aus den Papyri für das Original hält, woher weiß man, ob man dort nicht auch gerade einen Kopierfehler vor sich hat, wenn es so viele davon gibt?
Nur mal als Bsp zu P66 und P75:
Streitenberger:
„Festzuhalten sind folgende Kennzeichen: Der Schreiber P66 produziert ungrammatische Sätze, verwechselt Buchstaben (d.h. erkennt nicht, dass das Wort falsch ist), vergisst Objekte und Prädikate. Das würde einem Griechischkenner nicht in diesem Ausmaß passieren. P66 enthält nahezu durchgängig fehlerhaftes Griechisch und scheidet als Zeuge aus.“
P66: it is very poor and sloppy according to E.C. Colwell. He reports nearly 200 nonsensical readings and 400 mistaken spellings.
Colwell, „Scribal Habits in Early Papyri”, pp. 387, 378–379; see Pickering, S. 130.
P75 is not as bad as P66 but Colwell affirms (S. 374) there are over 400 mistakes which include about 145 misspellings and 257 singular readings of which 25% are nonsensical (Pickering, S. 104).
Betrachten wir P46:
Diese Hss. hat 160 Korrekturen, 668 Singulärlesarten, 141 Rechtschreibfehler, 56 nonsense readings und 115 Harmonisierungen (nach Heide, S. 123).
Ist das ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. ich meine nicht.
Die Tatsache, dass in den byz. Hss. auch zweifelsfrei sprachliche Glättungen und Wortumstellungen enthalten sind, die zu einem besseren Griechisch führen, ist mir auch klar. DAs leugne ich gar nicht. Aber das führt m.E. nicht dazu, dass die Textdifferenzen mit inhaltlichen Abweichungen (dh die byz. LA mit inhaltlichen Abweichungen, die im alex. Text nicht enthalten sind und im NA in den Apparat wandern) nicht urpsrünglicher sind. Zumal wenn diese byz. LA dann auch noch ständig von den Kirchenvätern zitiert werden.
„Viele byzantinische Lesarten sind früh entstanden, und etliche sind nach internen Kriterien ursprünglich. Vielleicht zeigen die Kirchenväterzitate ja sogar stellenweise gerade auch, dass Textkritiker sie als Quellen vernachlässigt haben und dass die enthaltenen Lesarten vielleicht doch höher zu gewichten sind.”
Dem hab ich nichts hinzuzufügen. Ergo ist der Großteil der byz. LA früh enststanden. Und meiner Auffassung daher auch zu bevorzugen, da er sich (etwas später) eben auch in den byz. Hss. findet, die aus dem Kerngebiet des Christentums kommen, wo die Originale geschrieben wurden und wo die Adressaten der Originale waren. Dort wußte man am besten, was der richtige Text ist.
Wie gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich antworten kann. Es diskutiert wohl einfach keiner mit, weil unser Blog noch nicht gar so viele Leser hat, die Kommentare auch nicht so prominent platziert sind und diejenigen, die sie doch sehen, vermutlich kaum textkritisches Wissen haben.
Ich fasse meine Meinung zum MT mal zusammen:
Es ist am plausibelsten, dass der MT der vertrauenswürdigere Text ist, weil so viele logische Gründe dafür sprechen:
1.) Maurice Robinsons main point ist für mich überzeugend und durch die Argumente des NA-camps nicht plausibel widerlegt: The issue which needs to be explained by any theory of NT textual criticism is the origin, rise and virtual dominance of the Byzantine Textform within the history of transmission. Various attempts have been made in this direction, postulating either the “AD 350 Byzantine recension” hypothesis of Westcott and Hort or the “process” view promulgated by modern schools of eclectic methodology. Yet neither of these explanations sufficiently accounts for the phenomenon. The alternative hypothesis has been too readily rejected out of hand, perhaps because it is by far the “least interesting” in terms of theory and too simple in praxis application: the concept that the MT may in fact more closely reflect the original form of the NT text than any single MS, small group of MSS, or texttype.
Heißt: Wie konnte es zum plötzlichen Auftreten und zur Dominanz des MT kommen, wenn er nicht der Originaltext ist? Haben ab dem 5. Jhrdt auf einmal an ganz vielen unterschiedlichen Orten Kopisten, die sich nicht kannten, auf wundersame Weise praktisch immer an denselben Stellen Text hinzugefügt? Und das über viele Jahrhunderte fast immer unisono? Ist das nicht komplett unwahrscheinlich? Und warum ist der Text nicht weiter auseinandergedriftet?
Generally speaking, as texts move further from their source in time and distance they become more and more divergent. How then could the manuscripts become more and more uniform as they moved past the 4th century, and the Byzantine Text-type began to take predominance? If it was not based on an early exemplar one would expect to find more divergence as time passed and as the regions that it was found in expanded. But we find quite the opposite. We actually find that, though time from the exemplars increased and the territories that it was found in spread, the text became more uniform. This would at least hint to an early exemplar(s) that the different regions began to go back to after the church was settled from much persecution.
2.) Beim AT handelt sich um einen sehr uneinheitlichen Lokaltext, bei dem nicht bewiesen ist, dass er über Ägypten hinaus benutzt wurde Der MT kommt dagegen aus einem riesigen geographischen Bereich (Byzanz, Europa).
3.) Der MT kommt aus dem Bereich der Urkirche, in dem die Apostel gewirkt haben und an die die Urschriften geschickt wurden und wo die Urschriften noch lange zur Verfügung standen. Dort war ein Abgleich mit den Originalen eher möglich als in Ägypten. Wo wusste man wohl am besten, was das ursprüngliche Wort Gottes ist?
4.) Der MT ist kein Einheitsbrei, den man auf viele Kopien einer Urschrift zurückführen kann. Bei all seiner erstaunlichen inneren Übereinstimmung, besitzt er genügend Differenzen, die zeigen, dass er eine Vielzahl von verschiedenen Ursprungsquellen repräsentiert und nicht eine Hss. tausende Mal kopiert wurde. Die gewaltige Übereinstimmung unter den Hss., die er dennoch enthält, ist aber ein gewichtiges Argument für seine Authentizität. Nähe zum Original zeigt sich dann nicht, wenn Texte diffus sind und diffuser werden (so wie im AT).
5.) Der ägyptische NA-Text ist aus inneren Gründen sehr problematisch: Ägypten war bereits in der Frühzeit der Kirche stark durch fundamentale Irrlehren geprägt (Gnosis). Dies kommt in manchen Lesarten zum Ausdruck (z.B. Joh 1,18; 1Tim 3,16) und wird von Kirchenvätern bestätigt.
Origen, the Alexandrian church father in the early third century, said: „…the differences among the manuscripts [of the Gospels] have become great, either through the negligence of some copyists or through the perverse audacity of others; they either neglect to check over what they have transcribed, or, in the process of checking, they lengthen or shorten, as they please.”
6.) Der MT kann sich auf die allermeisten Handschriften abstützen. Mindestens 90% der ca. 5300 uns heute zur Verfügung stehenden griechischen Manuskripte enthalten den MT. Der ägyptische Text wird lediglich durch ca. 2 – 5% der Handschriften gestützt (v.a. im NA durch B, Aleph und P75). Das könnte ein Zeichen für eine Bewahrungshandlung des MT durch Gott sein.
7.) Der Text der frühen ägyptischen Papyri wurde von der frühen Kirche nicht angenommen, denn der AT wurde nicht massenweise kopiert (auch nicht in Ägypten!) und in ganz Europa zirkuliert. Selbst von den Hauptzeugen des NA (B und Aleph) wurden keine Nachfolge-Kodizes kopiert! Das ist schon sonderbar, wenn diese beiden Hss. doch als die besten propagiert werden.
8.) Die Christen aus dem Gebiet der Urkirche haben nach dem Ende der Christenverfolgung offensichtlich eine Entscheidung zugunsten des MT und gegen den AT getroffen. Sie waren am nähesten am Thema dran. Das sollte man respektieren.
9.) Das einzige Argument, was evident gegen den MT und für den AT spricht, ist, dass die bislang gefundenen frühen Hss. NICHT reinen byz. Text haben. Warum also nicht NA mit den frühen ägyptischen Papyri bevorzugen?
a.) Erstens ist das Nichtvorhandensein noch früherer Hss. vom MT logisch erklärbar: Noch frühere Hss. aus Byzanz sind aus klimatischen Gründen zerstört worden. Aus den ersten 7 Jhdt. gibt es im Mittelmeeraum fast überhaupt keine antiken Hss. und natürlich auch (erst recht) keine christlichen! Zu berücksichtigten sind dort auch mehre Wellen der Christenverfolgung, in denen chrisltiche Hss. verloren gingen.
b.) Zweitens sagt das Alter der Hss. nichts über das Alter des darin enthaltenen Textes und die Zahl der Abschriften bis zu dieser Hss. aus. Eine Hss. aus dem 6. Jhrdt kann eine direkte Kopie einer Hss. aus dem 2. Jhrdt sein, eine Hss. aus dem 4. Jhrdt. kann dagegen die 10 Abschrift eines Textes aus dem 3. Jhrdt sein.
c.) Drittens fangen die ersten größeren byz. Hss. (A und W) bereits 50–70 Jahre nach den maßgeblichen Hss. des AT – B, Aleph – an. Der time gap zwischen den „price jewels“ des AT und den ersten MT-Hss. ist also v.a. im Vergleich zu sonstigen antiken Werken minimal.
d.) Viertens sind die frühen Funde aus den ersten Jhrdt. von der Datenmenge ohnehin so klein (fast nur Schnipsel und ganz wenig!) und lokal auf Ägypten beschränkt, dass sie kaum repräsentativ sind.
e.) Fünftens: NA-Hss. sind zwar minimal älter als die byz. Hss., aber die Ware ist unbrauchbar. Warum?
• So viele grammatische Fehler (v.a. Auslassung wg. Homoiotel.) in jeder Hss. und so viele Textunterschiede zwischen den frühen alex. Papyri, dass die Rekonstruktion eines Grundtextes daraus ein Ping-Pong- u. Ratespiel ist. Die Papyri widersprechen sich laufend, eine Text auf dieser Grundlage ist gar nicht möglich, da der eine so, der andere anders kopiert hat.
• Die vielen Unterschiede zw. den Papyri deuten auch darauf hin, dass der frühe Text nicht der von Gott bewahrte Urtext sein kann. Ist es plausibel, dass Gott den Urtext so präsentiert? Dass wir ständig raten müssen, welchen Abschnitt einer Hss. wir nehmen?
• Und wie will man erklären, dass der Originaltext des Neuen Testaments in den ersten zwei bis drei Jahrhunderten so zerschreddert wurde, dass sich kein Manuskript mehr finden ließe, das mehr als fünf Verse dieses angeblichen Originals unverändert beibehalten hat?
• Und die alte Ware ist nicht nur unbrauchbar, sondern die frühen Papyri sind zudem eigentlich gar keine eigene alexandrinische Textfamilie (außer Vaticanus und P75), die man als Vorlage nehmen kann. Robinson: „Even the Alexandrian text is not thoroughly present in the early Egyptian papyri except in P75. All other papyri represent levels of mixture with readings from other traditions (including the Byzantine) or purely scribal creations.“
f.) Sechstens: Das Abstellen auf B und Aleph „beißt sich“ mit Gottes Versprechen, sein Wort für die Gläubigen zu bewahren. Denn damit passt es nicht zusammen, einen Text nach kurzer Zeit aussterben zu lassen, ihn dann über 1400 Jahre vor der Mehrheit der Gläubigen zu verstecken. Das, was zum NA-Text wurde (dh der AT), den gab es nur im engen Raum von Ägypten in den ersten Jhrdt, dann wurde er praktisch nicht mehr weiter kopiert. Wie soll das der bewahrte Text sein?
g.) Finally: Der MT läßt sich als Texttyp klar auch vor 400AD nachweisen.
• Es gibt viele typische byz. LA unter den frühen ägyptischen Manuskripten (vgl. allleine die Untersuchungen von Sturz), Sinaiticus hat ca. 25–35% byz. Text, Vaticanus weist durch die vielen Umlaute auf MT-Lesarten hin.
• Es gibt viele byz. LA in den frühen Kirchenväterzitaten/ANF, obwohl diese mehrheitlich nicht aus dem byz. Reich kommen. Woher haben die ANF die LA wohl?
• und in einigen alten Bibelübersetzungen aus ganz Europa (mehrheitlich Peschitta, Old Latin-Hss., Gotische Bibel – alle aus den ersten 4 Jhrdt!).
Dies spricht nicht nur deutlich gegen eine späte künstliche Schaffung des MT sondern stellt auch einen Beweis für die frühe Existenz des MT dar (von irgendwelchen Vorlagen müssen die diversen byz. LA ja kommen!). „The MT has left its footprints.“
Moin Benjamin,
da mein letzter post zu deinem Input wohl unbeantwortet bleibt und andere Christen sich wohl bei dieser Textfrage nicht beteiligen wollen (was ich schade finde), eine andere Frage:
Was haltet ihr von der Neuen Luther Bibel (buona novella) im Vergleich zur Schlachter Bibel, die ja auch auf dem TR basiert? Welche ist besser?
Hallo Torsten, Hallo Benjamin,
erstmals danke ich euch für eure sachliche Diskussion! Mit dem Thema der Textgrundlagen habe ich mich versucht zu beschäftigen. Ich müsste leider feststellen, dass für einen Leihen wie ich, die Diskussion zu verwirrend ist und die Zeit, um mich in die textkritische Methodik einzuarbeiten, habe ich leider nicht. Ich habe versucht die Argumente von den beiden Lagern anzuschauen. Was mir aufgefallen ist, dass die MT Verfechter sehr oft polemisch argumentieren, zumindest im deutschen Sprachraum und die NA Verfechter sich zu sehr auf die Methodik verlassen und „aufgeblasen“ argumentieren. Bei NA Leuten hat sich gewisse Fachblindheit eingeschlichen, was an sich nichts außergewöhnliches ist. Es ist üblich, vor allem für die Wissenschaftler. Ich habe so ein Eindruck, dass beide Lager ihre eigene Argumente nicht kritisch anschauen wollen. Gab es eigentlich schon ein Gespräch an einem runden Tisch mit den Vertretern der beiden Lagern? Es geht doch, um eine sehr wichtige Sache, nämlich um das Wort Gottes und nicht wer den Recht behält. Noch dazu kommt, dass bei einfachen Christen wie ich, diese sehr oft unweise geführte Diskussion, eine Unsicherheit und gar Zweifel an der Richtigkeit des Textes der Bibel hervorruft. Ich würde mir wünschen, dass ein Universaldenker mal objektiv die Argumente beide Lager untersucht und zusammenfasst. Vielleicht existiert so eine Arbeit bereits, dann schreibt mir kurz.
Ich persönlich finde Schlachter 2000 besser, aber es ist eine subjektive Meinung, da Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Neue Luther 2009 finde ich von der Satzbau zu deutsch und zu verschachtelt. Zu einem Vergleich mag ich auch Elberfelder 2003 CSV einzubeziehen. Sie folgt nicht blind dem NA, weicht im NT glaube ich an ca. 400 Stellen davon ab.
Ich wünsche euch meine Brüder im Herrn Jesus, Gottes Segen und viel Weisheit im Umgang mit dieser Frage.
Viele Grüße
Eugen
Lieber Eugen,
da trau ich doch meinen Augen nicht. Es beteiligt sich jemand an dieser Diskussion! Vielen Dank erstmal dafür! Ich bin ja auch Laie, habe aber mittlerweile so viel dazu gelesen, dass sich doch einiges an Wissen angehäuft hat. Hier gilt aber die alte Weisheit: The more I know, the more I am confused.
Was war denn dein Grund, lieber Eugen, dich für den Mehrheitstext/TR und die Schlachter zu entscheiden!
Gottes Segen!
Jesus ist der Christus und der HERR!
Euer
Torsten
Lieber Torsten,
sorry, dass ich nicht gleich geantwortet habe!
Zu MT tendiere ich aus folgenden Gründen:
1. Die Erklärung der NA Lagers bzgl. der Glättung des Textes durch Kopieste oder die absichtliche/unabsichtliche Hinzufügungen scheint mir rein mathematisch (statistisch) unwahrscheinlich. Auch über längeren Zeitraum. Ohne einer Absicht mit einer zentralen Steuerung ein Text aus mehreren Quellen über längeren Zeitraum zu verfälschen finde ich fast nicht machbar.
2. Auch falls ich bei einer oder anderen Leseart feststellen sollte, dass sie falsch wäre, dann ist es für mich einfacher in meiner Bibel ein Vermerk zum vorhandenen Text zu machen als ein Vers rein zu schreiben. Der Argument ist subjektiv. Ich lese gerne in einer gedruckten Bibel und möchte wegen dem fotografischen Gedächtnis so lange wie möglich sie behalten. Ich weiß auch dem Textbild nach wo was in meiner Bibel steht.
Zu Schlachter Übersetzung aus folgenden Gründen:
1. Schlachter Übersetzung finde ich gut verständlich und trotzdem haben die Übersetzer sich bemüht nahe dem Grundtext zu bleiben. Das ist natürlich eine Beurteilung aus dem was ich über die Übersetzung gehört und gelesen habe. Ich kann leider kein Altgriechisch oder Hebräisch/Aramäisch.
2. Ich wollte nicht mehr länger am Wort Gottes zweifeln. Und nach dem ich ziemlich viel über dieses Thema gelesen habe, wählte ich für mich zwei Übersetzungen ( Schlachter 2000 und Elbelfelder CSV 2003). Schlachter 2000 habe ich als meine reguläre Bibel und CSV 2003 nehme ich gerne zum Vergleich. Viele Argumente sind dafür subjektiv. Ich habe auch viel dafür gebetet (es gehört nicht zu einem subjektiven Faktor :)).
Rückblickend würde ich mir wünschen von diesem Thema nichts gewusst zu haben. Versteh bitte nicht falsch, ich finde dieses Thema wichtig und ich scheue keine Mühe mich damit auseinander zu setzen, nur das Problem ist, um allein die widersprüchliche aussagen der Fachläute zu beurteilen, braucht man einiges an Hintergrundwissen. Die Zeit habe ich leider nicht. Die Unterschiede im Text finde ich auch erlich gesagt für ein praktisches Leben als Christ nicht so gravierend. Ich muss auch irgendwo die Verantwortung abgeben an die Geschwister die eine Fachkompetenz haben. Sie werden in Ihrer Zeit für die ihnen anvertrauten Gaben vor dem Herrn Rechenschaft ablegen und ich für meine.
Ich wünsche dir Bruder Gottes Reichen Segen und Freude an Seinem Wort! User Herr Jesus Christus wird uns ans Ziel bringen! Das ist Gnade.
VLG Eugen
Lieber Eugen,
das ist schon witzig, ich empfinde das so ähnlich wie du. Vor ca. 13 Jahren fing mein Wissenshunger nach der Grundtextfrage an und ich habe seitdem ca. 20 Bücher dazu gelesen und hunderte von Stunden im Internet recherchiert (v.a. viele englische/US Beiträge dazu gelesen). Im Nachhinehin hat das „nur” dazu geführt, dass ich weniger in der Bibel gelesen habe und ständig nur auf der Suche war nach dem EINEN Beitrag, der für mich alles klar machte.
Den habe ich aber nie gefunden. Momentan lese ich auch Schlachter 2000 und will mich eigentlich mit dem Grundtextthema auch gar nicht mehr beschäfigten. Kann da auch der Teufel für verantwortlich sein? Dass man immer auf der Suche ist, dadurch GOTTES Wort nicht liest, keine tätlichen Früchte bringen kann, „hat Gott wirklich gesagt?”…
Jesus ist der HERR!
Dein
Torsten
P.S. Wir sind die beiden einzigen, die hier schrieben. Das ist echt schade. Benjamin hat sich wohl auch ausgeklingt.
.. vor 3 Jahren, nicht 13.
Guten Morgen lieber Torsten,
interessant ist, dass ich gestern auf dem Weg zur Arbeit,die gleiche Gedanken gehabt habe. Ich müsste auch an die Verführung von Eva denken und an den Trick des Satans den er immer wieder anwendet. Es gibt nichts schlimmeres für eine Christen als zweifel am Wort Gottes.
Ich denke es wird Zeit für uns aufzuhören zu suchen. Lieber lass uns die Zeit mit Seinem Wort verbringen und das umzusetzen was der Heiliger Geist uns gezeigt hat. Wenn wir aber es auswendig können, dann können wir immer noch überlegen, ob wir die Grundsprachen der Bibel lernen und in weiteren Themen nachforschen. Ich denke da haben wir für die nächste ein paar Jahre zu tun 🙂
Ich bete für dich Bruder, dass du wieder Freude am Wort Gottes, Vertrauen in das Wort Gottes und Beute im Wort Gottes haben darfst.
Unserem Ewigen und Allmächtigen Gott dem Herrn Jesus Christus anbefohlen!
VLG Eugen
Lieber Eugen,
das ist lieb von dir! Möge Gott dich dafür belohnen, bei SEINER Wiederkunft!
Und: Selbst wenn wir die Grundtextsprache Griechisch lernen würden, würde uns das wenig bringen. Denn auch dann stellt sich ja die Frage, welche der vielen Hss. wir unser Vertrauen schenken, Eugen. Nicht wahr?
Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist: Wo kommst du denn her? Lebst und arbeitest du in Deutschland?
Gottes Segen!
Dein
Torsten
Lieber Torsten,
ich bin seit 2,5 Jahren immer mal wieder auf das Grundtextdilemma gestoßen und hätte ebenfalls lieber nichts davon gelesen… und mehr Zeit direkt mit der Bibel verbracht!
Deiner Argumentation entnehme ich aber, dass du eigentlich vom Mehrheitstext überzeugt bist, selbst, wenn du es selbst nicht so siehst ;). Ich glaube, das würde jeder deinen Argumenten letztlich entnehmen. Also bleib einfach bei Schlachter2000, wie es dein Gewissen dir sagt.
Für mich ist es eher so, dass ich N.A. nicht blindlings vertrauen würde, ohne gleich komplett den MT zu bevorzugen [mir ist die textkritische Beurteilung von der Ehebrecher-Perikope Joh 8 und Markus-Schluss überhaupt nicht nachvollziehbar, auch wenn diese Stellen in N.A. wenigstens eingeklammert angegeben sind]. Wem es ebenfalls so geht, dem ist, wie schon von Eugen gesagt, die Elberfelder CSV zu empfehlen, weil sie an inhaltlich relevanten Stellen eigenständige Textentscheidungen gewählt haben und so sogar 700 Mal von N.A. abweichen, aber 400 Mal die N.A.-Variante wenigstens aufweisen (von den 6000 Varianten sind ja längst nicht alle übersetzbar und schon gar nicht alle inhaltlich relevant, wie z.B. die häufige Ersetzung von „er” N.A. durch „Jesus” MT sagt ja inhaltlich das gleiche aus, deswegen ist es ja ein PROnomen).
Viele Grüße
Benjamin
Hallo Torsten,
da hast du wohl Recht, wobei ich werde dann versuchen, von Fall zu Fall eine Entscheidung zu treffen. Über mich persönlich schreibe ich ungerne in öffentlichen Foren oder Blogs. Das Internet vergisst nichts. Gibt es eine Möglichkeit über Faithlife zu kommunizieren?
VLG Eugen
Hi Eugen,
bei Faithlife bin ich nicht. Was ist das?
Sonst schreib mir gern über meine Dienstadresse eine Email (tipp mal einfach bei google Kaiserseminare in Lübeck ein, das bin ich).
LG und Gottes Segen!
Dein
Torsten
Ich bin ein ungläubiger Mensch, besitze aber mehrere Bibel-Ausgaben.
Aber für mich ist „Das Buch der Bücher” zunächst nur eine ganz gewöhnliche Anthologie, die in der heutigen Form erst seit dem vierten
Jahrhundert existiert, als der Heidenkaiser Konstantin etliche Kirchen-
väter aufforderte, ein einheitliches Werk zusammenzustellen, da es im
Vorderen Orient mehrere christliche Gemeinden gab, die unterschied-
liche Schriften für ihre Gottesdienste verwendeten. Und zum Beispiel
– wie die Arianer – die Trinität nicht anerkannten. Die im übrigen auch
erst auf dem Konzil zu Nicäa festgeschrieben wurde.
Mir selbst konnte bislang kein gläubiger Mensch und auch keine Theo-loge die zahlreichen Fragen beantworten, die ich stellte.
Fast alle Antworten, die ich erhielt, waren wiederum nur Bibel-Zitate, aber das halte ich für absurd.
So lange mir niemand befriedigende außerbiblische Antworten
geben kann, ist „Das Buch der Bücher” nur eine ganz gewöhnliche
Anthologie, die in weit mehr als einem Jahrtausend entstanden ist.
Lieber Herr Ocken,
ich glaube, darum geht es hier auf dieser Seite gar nicht. Sondern um die verschiedenen Grundtextarten.
VG
Torsten K.
Jetzt gibt es auch die analogen Bibelvers-Lernkarten zur Schlachter 2000. Wir sind begeistert!
https://aus-gnade.de/pages/wort-im-herzen
Hey Leute,
versteht doch einfach endlich mal, dass NA 2 Codexe (Codex Sinaiticus und Vaticanus) benutzt und dass diese 2 zu den 50 Prachtbibeln gehören, die Konstantin den Christen spendete.
Danach muss man nicht darüber diskutieren, welcher Text zuverlässiger ist.
Wie meinst du das?
Grüß dich! Leider habe ich etwas entdeckt, das mich stutzig macht: Phil.2, 4 wird in der Schlachter 2000 ohne das Wort „auch” übersetzt. Im Griechischen aber steht dieses Wort.
Lg Dagmar
Eine kleine Randbemerkung, mit allem gebührenden Respekt: Die Lutherbibel 1545 basiert aber ebenso auf den griechischen Textus Rezeptus und den masoretischen Text auf Hebräisch! Die „Neu durchgesehenen” Versionen der „Lutherbibel” wie man sie allzu gern nennt, sind genauso weit entfernt von Luther wie die sogenannte New King James Bibel von der Fassung 1611!